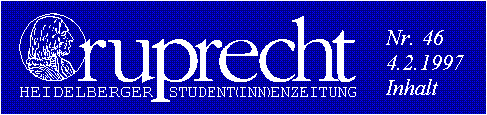
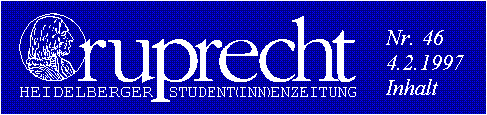
 Der ruprecht Nr. 46 in kleinen Häppchen
Der ruprecht Nr. 46 in kleinen Häppchen
 Titel
Titel
 Meinung
Meinung
 Hochschule
Hochschule
 Heidelberg
Heidelberg
 Kultur
Kultur
 Sport
Sport Verschiedenes
Verschiedenes
 Die Letzte
Die Letzte
Die Entscheidung fällt am 10. Februar: Überweisen bis dahin 8000 Heidelberger Studierende die neuen "Verwaltungsgebühren” nicht an die Unikasse, sondern auf das Treuhandkonto, wird Wissenschaftsminister Klaus von Trotha das Geld so schnell nicht sehen. Das Kalkül der Boykotteure: Einige wenige Studierende kann der Minister wie angedroht exmatrikulieren lassen; den Rauswurf Zehntausender im ganzen Land wird er nicht wagen. Denn überall in Baden-Württemberg wollen Studierende die neuen Gebühren boykottieren.
Die sonst so zerstrittenen hochschulpolitischen Gruppen sind sich erstaunlich einig: Die Verwaltungsgebühr müsse in organisierter Form boykottiert werden, weil sie anstatt den Hochschulen zunächst dem Land zufließt, während sich die Studienbedingungen weiterhin verschlechtern. Vor allem aber wird die neue Gebühr als "politischer Testfall für die Einführung allgemeiner Studiengebühren” (so der Arbeitskreis "Treuhandkonto” der Fachschaftskonferenz) gesehen.
Der Boykott ist nicht das einzige Mittel, mit dem studentische Aktivisten der Hochschulpolitik des Wissenschaftsministers Kontra geben wollen: Am 4. Februar führt um 13.00 Uhr ein Sternmarsch Studierender von der alten PH, dem Neuenheimer Feld und dem Uniplatz aus zu einer Kundgebung auf den Bismarckplatz. Philosophie-Studierende verkauften ihre Hausarbeiten in der Fußgängerzone, um Geld für ihren Fachbereich zu sammeln. Telefonaktionen nach dem Motto "Ich telefoniere gern” (mit dem Ministerium) beschäftigen Landesbeamte. Eine Arbeitskreis der Jura-Fachschaft bereitet eine Klage und eine Landtagspetition gegen die Gebühren vor. Nicht nur an der Universität, auch anderswo in der Stadt hat die FSK Informationsstände aufgebaut.
Die Studierenden wehren sich mit den größten Protesten der letzten acht Jahre, und selbst Rektor Ulmer gibt sich wenig begeistert von der Verwaltungsgebühr. Er sähe das Geld lieber direkt im Hochschulsäckel statt in den schwarzen Löchern des Landeshaushalts verschwinden.
Zudem hätte sich die Univerwaltung nun mit dem Protest der Studierenden auseinanderzusetzen, ohne daß die Mehreinnahmen ein tatsächlich ausreichendes Maß erreichen würden. Warum er dennoch nicht im Ministerium protestiert? Er sieht in dieser zusätzlichen Einnahme eine Erleichterung der Finanzierung des stark beschnittenen Hochschuletats, wenn auch keine zufriedenstellende. Vielmehr würde der Rektor nach wie vor die Einführung von allgemeinen Studiengebühren mit Sozialklausel begrüßen, denn nur so könne man das Finanzierungsloch der Heidelberger Universität von 21 Millionen wirklich schließen. Nicht geklärt ist, wie stark der Protest der Studierenden in diesem Falle wäre. (Siehe nebenstehendes Interview).
Der zuständige Dezernent Eckhard Behrens wies darauf hin, daß Verwaltungsrat, Rektorat und Senat schon seit längerem vergeblich einen Globalhaushalt fordern. Würde die Universität über einen solchen verfügen, könnte sie selbst über die Mittelverteilung bestimmen. Erst dann hätte sie wirklich einen Vorteil von der direkten Einnahme der Verwaltungsgebühr, die sie so nach eigenem Gutdünken verwenden könnte. Auch bestünden, so Behrens, keine Verträge zwischen Land und Universität, die die Finanzierung auf längere Sicht absicherten, wie dies in anderen Bundesländern (z.B. Niedersachsen) der Fall ist. Das läßt vermuten, daß die Universitätsverwaltung sich durch die kurzfristigen Mehreinnahmen durch Einschreibegebühren vom Land Zugeständnisse in Sachen Reform der Hochschulfinanzierung verspricht. Diesen Zusammenhang sah Rektor Ulmer auf Nachfrage allerdings nicht.
Während die FSK gehofft hatte, daß die Verwaltung bereit wäre, Informationsmaterial über das Treuhandkonto zu verschicken, warnte Behrens in einer Pressemitteilung, Flugblättern und sogar auf der studentischen Vollversammmlung vor dem Boykott. Auf unsere Anfrage hin begründete Behrens dies mit der Informationspflicht gegenüber den Studenten: "Wir können euch das Risiko nicht abnehmen.”
Erst in letzter Minute kam die endgültige Absage des Rektorats bezüglich der Infobriefe. "Das ist doch reine Verunsicherungstaktik!” sagte FSK-Vertreter Tobias Horn, "anderswo hat die Verwaltung auch nicht zur Revolution aufgerufen, aber der Treuhand-Aktion zumindest keine Steine in den Weg gelegt.” In Tübingen und Stuttgart hatten die zuständigen Dezernenten auf den Vollversammlungen neutral über die Risiken informiert und auf die Möglichkeit der Hochschulen hingewiesen, die Mahnungszustellung zu verzögern. Das Rektorat in Karlsruhe geht noch einen Schritt weiter: es verteilt Plakate, die auf die Gefahrlosigkeit der Boykotteilnahme bis kurz nach Erhalt der Mahnung verweisen. Wissenschaftsminister von Trotha hat schon sehr gereizt auf die Boykottankündigungen und den damit verbundenen Presserummel reagiert: "Wer glaubt, ein demokratisch beschlossenes und sachlich gerechtfertigtes Gesetz durch einen Boykott aushebeln zu können, muß die Konsequenzen tragen.” Inwiefern ein solches Gesetz tatsächlich "sachlich gerechtfertigt” ist, bleibt umstritten. In einer Empfehlung des Rechnungshofes wird die durchschnittliche Bearbeitungszeit für eine Rückmeldung zwischen 1,3 und 3,6 Minuten angesetzt. Dazu MdL Carla Bregenzer (SPD): "Eine Rückmeldegebühr von 100 DM für einen Verwaltungsakt von 1-3 Minuten ist, gelinde gesagt, ein stolzer Preis.” Ein guter Ansatzpunkt für Gerichtsverfahren über die Rechtmäßigkeit der Gebühren.
Aber warum eigentlich die Aufregung um einen "Peanuts”-Betrag von hundert Mark? Mit etwa neunzig Pfennig pro Tag im Semester könnten die Studierenden, so von Trotha, "einen moderaten Finanzierungsbeitrag ... zu den unter Finanznot leidenden Hochschulen” leisten. Immerhin hat die Hochschule zur Zeit noch gravierendere Probleme als die Einführung von Gebühren zu diskutieren: die Schließung ganzer Institute, den Umgang mit Kürzungen bei Personal und Einrichtung, steigende soziale Ungleichheit bei den Studierenden oder auch die Aufhebung des Beamtenstatus für den Lehrstuhl. Deshalb sind für Rektor Ulmer die Verwaltungsgebühren auch nicht das "zentrale Thema”. Die Motivation der Proteste beschränkt sich jedoch nicht nur auf eine private Sparmaßnahme. Sie ist eine politische Aussage: Auch wenn Trotha jetzt nicht von allgemeinen Studiengebühren sprechen will, hat er diese noch im Herbst für das Jahr 1998 in Aussicht gestellt. Die Treuhandidee steht also in einem größeren Zusammenhang. Sie wird zeigen, ob sich die Studierenden als Gruppe in die Hochschulpolitik einschalten können und wollen.
Richtig spannend wird die Sache erst, wenn die Mahnungen verschickt sind. Wer sich jetzt am Boykott beteiligt, riskiert gar nichts. Sind am Stichtag, dem 10. Februar, noch keine 8000 Überweisungen eingetroffen, werden die Beiträge an die Universitätskasse überwiesen. Damit hätten sich die Verwaltungsgebühren jedoch endgültig etabliert.
(cw, gan, hn)
Die Kassen sind leer, ein Volkswirt muß her. Am 10. Februar soll der Wirtschaftswissenschaftler Jürgen Siebke zum neuen Rektor der Universität Heidelberg gewählt werden. So hat es die "Rektorfindungskommission” beschlossen, die dem Großen Senat Kandidaten zur Wahl vorschlagen soll. Die vorzeitige Kür eines Rektors wird nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Peter Ulmer - wie Eingeweihte erwartet hatten - Ende September aus Altersgründen ausscheiden möchte.
Einen Gegenkandidaten wird Siebke nicht haben; den mußte seit zwei Jahrzehnten keiner seiner Vorgänger fürchten. Die Amtsanwärter werden von der "Ruperto Carola”, der stärksten Professorenfraktion in den Senaten, vorgeschlagen, der Rest der Professorenschaft pflegt sich an den Vorschlag zu halten. Im Großen Senat, dem formalen Wahlort, sitzen in Heidelberg sieben gewählte Vertreter der Studierenden, des Mittelbaus und der sonstigen Mitarbeiter, außerdem 21 Professoren, die 15 Dekane, der Rektor, die drei Prorektoren und der Kanzler: eine solide Mehrheit also für die Professoren. Der Rektor muß C4-Professor sein und wird für vier Jahre gewählt. Seine Amtszeit beginnt am 1. Oktober. Daß nur ein Kandidat zur Auswahl präsentiert wird, ist nicht überall so: Andere Universitäten des Landes kennen konkurrierende Kandidaten.
Geboren wurde Siebke 1936 in Hannover. Er studierte Volkswirtschaftslehre in München, Kiel und Bonn. Nach seiner Promotion 1965 und Habilitation 1971 wurde er Professor für theoretische Volkswirtschaftslehre in Kiel. 1975 wechselte er nach Essen, bevor man ihn 1983 schließlich auf den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik in Heidelberg berief. Sechs Jahre lang war er Mitglied des Wissenschaftsrates, wurde 1988 für zwei Jahre Dekan seiner Fakultät und ist es wieder seit 1995.
Nimmt man seine bisherigen Äußerungen als Anhaltspunkt, dürfte Siebke Wissenschaftsminister Klaus von Trotha bei der Einführung von Studiengebühren kaum im Wege stehen. Er hat sich in der Hochschulpolitik vor allem als Befürworter von "Bildungsgutscheinen” engagiert und steht Studiengebühren prinzipiell nicht abgeneigt gegenüber. Er hält es für selbstverständlich, daß sich Studierende an der Finanzierung universitärer Leistungen beteiligen und Gebühren, z.B. für EDV- oder Sprachkurse, zahlen.
In jedem Fall werden die Königsmacher damit rechnen müssen, daß Siebke sein neues Amt aktiv ausfüllen wird und es nicht als die lästige "Unterbrechung der Forschungstätigkeit” auffaßt, als die es Ulmers Vorgänger Volker Sellin sah. Wer Siebke kennt, prophezeit auch eine "Amerikanisierung der Universität”: stärkeres Leistungsdenken, weniger Verständnis für "Orchideenfächer”, deutlichere Ausrichtung der Universität auf die Bedürfnisse der Wirtschaft - auch, um im Gegenzug mehr Geld in die Hochschule zu holen.
Studierende, die mit Siebke im Rat seiner Fakultät zu tun hatten, sehen schlechte Zeiten anbrechen: "Anträge, die wir gestellt haben, hat er mehrmals einfach abgebügelt, sich gar nicht erst damit befaßt. Es fällt ihm schwer, mit uns zu reden. Fast könnte man meinen, er hätte Angst vor Studierenden.” (gz)
Ja ja, ich weiß, ich hätte auf meine Mutter hören
sollen. Schon früher schärfte sie mir ein: Mach nie
die Tür auf, wenn du nicht weißt, wer davor steht!
Aber nein, ich wollte ja nicht hören.
Gerade als dieser Typ mit den grünen Haaren "Bärbel”
erklärte, warum er nur blonde Männer lieben kann, klingelte
es. Nichts ahnend drückte ich auf den Türöffner.
"Müller, Süddeutscher Rundfunk”, schnarrte
mich die Stimme an, die zu dem wippenden Dienstausweis gehörte.
"Halten Sie ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereit?”
Ach ja, die GEZ hatte mir diese Frage schon zweimal schriftlich
gestellt. Und der säuselnden Frauenstimme am Telefon erzählte
ich später dann wahrheitsgemäß, daß mein
Vermieter - damals wohnte ich noch zur Untermiete - einen Fernseher
habe. "Wie heißt der? Glotzer... Hugo Glotzer...? Der
ist bei uns aber gar nicht registriert.” Ups, Eigentor! Naja,
kurz darauf zog ich eh um. Doch die Drohbriefe verfolgten mich
weiter. Bis zu jenem gewissen Tag, als ich nicht auf meine Mutter
hörte...
Aber es gab noch eine Chance: Befreiung von den Gebühren.
Wenn denn mein Einkommen unter dem Eineinhalbfachen des Sozialhilfesatzes
liegt.
Also fix ausgerechnet, ab ins Bürgeramt, und - geschafft!
Knapp unter der Höchstgrenze.
Von der GEZ habe ich bisher allerdings erst zwei Zahlungsaufforderungen
statt einer Bestätigung über die Befreiung bekommen,
aber das wird wohl noch. Oder?
Da war nämlich noch diese Studentin, die auch ein Einkommen
von ca. 750,- DM angegeben hatte und plötzlich von der Finanzbehörde
der Lüge bezichtigt wurde, da diese Summe weit unter dem
Existensminimum von 1300,- DM liege. Und wie steht es mit dem
BAföG-Höchstsatz von z. Z. 995,- DM, fragte sich auch
ein Bremer Student und zog vor Gericht. Das Urteil: Ja, der BAföG-Höchstsatz
liegt zwar unter dem Existenzminimum, aber das ist den Studierenden
zuzumuten. Und damit rechtlich, und Punkt. Aha.
Und was mache ich nun mit meinem Fernseher, ohne BAföG
und zwei Zahlungssaufforderungen der GEZ? Vielleicht sollte ich
es wie Peter halten, der seinen Fernseher einfach aus dem Fenster
warf. Aber da ihm das eh niemand glauben würde, schrieb er
sich selbst eine Rechnung über den Verkauf seiner Glotze.
Und diese Lüge, die sein mußte, weil die Wahrheit wie
eine Lüge klang, wurde ihm dann auch als wahr abgenommen.
Aber, meine Mutter sagte früher immer, ich solle nicht
lügen... (gz)
Beteiligung der Studierenden am Boykott der Verwaltungsgebühren:
http://wwwrzstud.rz.uni-karlsruhe.de/~px01/Boykott/index2.html
Zum Sommersemester '97 hat der Landtag Verwaltungsgebühren in Höhe von 100 DM beschlossen, die bei der Einschreibung bzw.der Rückmeldung zusätzlich zum Beitrag für das Studentenwerk bezahlt werden sollen. Dieses Geld fließt direkt ans Land und steht nicht dem Universitätshaushalt zur Verfügung. Hier nun das Für und Wider.
"Nein"
Prof. Dr. Jürgen Kohl
Institut für Soziologie der Universität Heidelberg
Ich halte Einschreibegebühren für ein ungeeignetes Mittel, die Situation der Hochschulen bzw. an den Hochschulen zu verbessern, und lehne sie daher grundsätzlich ab.
Ich bin zwar auch kein Befürworter von Studiengebühren, aber dafür ließen sich zumindest noch gewisse Argumente ins Feld führen, die auf die jetzt geplanten Einschreibegebühren nicht zutreffen. Studiengebühren sind u.a. mit dem Ziel vorgeschlagen worden, den Hochschulen eigene Einnahmen zu verschaffen. Doch unabhängig von der löblichen Absicht - der ich durchaus positiv gegenüberstehe - haben die mir bekannten Vorschläge bisher nicht deutlich machen können, wie institutionell sichergestellt werden kann, daß den Universitäten damit tatsächlich zusätzliche Mittel zur Verfügung stünden. Selbst wenn die Studiengebühren zweckgebunden den Universitäten zufließen würden, ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, daß die regulären (steuerfinanzierten) Haushaltsmittel entsprechend reduziert würden.
Die jetzt von der Landesregierung geplanten Einschreibegebühren sind dagegen nicht einmal zweckgebunden, sondern würden, soweit mir bekannt, als allgemeine Verwaltungseinnahmen in den Landeshaushalt fließen. Für Gebühren gilt im allgemeinen der Grundsatz, daß damit lediglich der Verwaltungsaufwand gedeckt werden soll. Jedoch ist mit der jetzt genannten Höhe von 100 DM pro Semester ein Betrag ohne nachvollziehbare Begründung festgesetzt worden. Von einer solchen Verwaltungsgebühr, die von jedem Studierenden erhoben wird, wird auch keine verhaltenssteuernde Wirkung ausgehen - jedenfalls keine positive. Eher ist zu befürchten, daß damit die finanzielle Situation insbesondere von Studierenden aus wirtschaftlich schwächeren Verhältnissen weiter verschlechtert wird, so daß eine solche Maßnahme am Ende sogar studienzeitverlängernd wirken könnte.
Meine Befürchtung ist deshalb, daß die Erhebung von Einschreibegebühren letztlich nur dazu dient, Haushaltslücken zu schließen, ohne daß den Universitäten im Endeffekt mehr Geld zur Verfügung steht. Wenn dieser Weg einmal eingeschlagen ist, kann man sich leicht ausrechnen, daß in künftigen Jahren weitere Kürzungen bei den regulären Haushaltsmitteln vorgenommen werden, die dann durch erhöhte Einschreibegebühren aufgefangen werden müßten - also eine Kette ohne Ende. Dazu kann ich nur sagen: Wehret den Anfängen! Wenn erst einmal der anfängliche Widerstand überwunden ist, wird man von politischer Seite gerne und in wachsendem Umfang von diesem fiskalischen Instrument Gebrauch machen, ohne daß damit für die Reform der Hochschulen und die Sicherung ihrer Funktionsfähigkeit etwas gewonnen wäre.
Letzteres wird man sicher nicht dadurch bewerkstelligen, daß man zuerst die Haushalte kürzt und dann erwartet, daß mit den gekürzten Haushaltsmitteln die Aufgaben in gleicher Weise (oder sogar besser) erfüllt werden. Bei steigenden Studienanfängerzahlen wären im Grunde sogar steigende Mittelzuweisungen erforderlich, um die Ausbildungskapazitäten entsprechend anzupassen und die Ausbildungsqualität zu erhalten. Bereits ein Einfrieren der Budgets birgt unter diesen Umständen die Gefahr einer Verschlechterung; bei realen Mittelkürzungen erscheint sie geradezu unvermeidlich. Ich halte es deshalb - vorsichtig gesagt - für sehr unrealistisch, daß Kürzungen in der jetzt diskutierten Größenordnung von 20 bis 30% ohne Qualitätseinbußen in Lehre und Forschung aufgefangen werden könnten.
Sicher gibt es auch an den Universitäten noch Sparpotentiale, da weder Verwaltungsabläufe noch Forschung und Lehre immer optimal organisiert sind. Dazu müßte nach Wegen gesucht werden, die interne Organisation und die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel so zu verbessern, daß mit den vorhandenen Ressourcen eine höhere Effektivität erreicht wird. Ein guter Ansatz hierzu scheint mir das Pilotprojekt "Dezentrale Ressourcenverantwortung” an unserer Universität zu sein, mit dem eine effektivere Ressourcenverwendung angestrebt wird. Die Ernsthaftigkeit der Sparbemühungen wird man auch daran messen können, ob das Land bereit ist, eine vergleichsweise bescheidene Mitfinanzierung für dieses innovative Projekt zu übernehmen, das kürzlich von der Stiftung Volkswagenwerk bewilligt wurde und von dem beachtliche Spareffekte ohne Leistungseinbußen zu erwarten sind.
"Ja"
Christoph-E. Palmer
Staatssekretär im Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg
Baden-Württemberg ist das hochschulreichste und forschungsintensivste Bundesland. Rund 230.000 Studierenden steht mit 9 Universitäten, 6 Pädagogischen Hochschulen, 24 Fachhochschulen und 8 Berufsakademien sowie 5 Musikhochschulen ein breit angelegtes und differenziertes Ausbildungssystem zur Verfügung. Der Hochschuletat hat in Baden-Württemberg einen Umfang von über 5 Mrd. DM pro Jahr. Ein Hochschulstudium ist also eine teure Sache. Nach unseren Berechnungen kostet zum Beispiel ein Studium an einer Universität im Durchschnitt 93.000 DM, an einer Fachhochschule 49.000 DM und an einer Berufsakademie 27.000 DM.
Die Einführung von Immatrikulations- und Rückmeldegebühren ist, mit Blick auf die angespannte Haushaltslage des Landes und die gewaltigen Einsparzwänge in allen öffentlichen Bereichen, ein zwar belastender, aber noch moderater Beitrag der Studierenden zur finanziellen Entlastung der Hochschulen. Es sei daran erinnert, daß ohne diesen Beitrag weitere 40 Mio. DM im Hochschulbereich hätten eingespart werden müssen. Bei den unumgänglichen Sparanstrengungen kann kein staatlicher Bereich mehr ausgenommen werden. Baden-Württemberg erhebt deshalb - wie Berlin - an den Hochschulen des Landes Immatrikulations- und Rückmeldegebühren.
Ab dem Sommersemester 1997 muß eine Gebühr von 100 DM pro Studierendem und Semester entrichtet werden. Diese Kostenbeteiligung der Studierenden erfolgt ausschließlich mit Blick auf die dramatische Haushaltslage des Landes. Die andernfalls im Bereich der Hochschulen für den Etat 1997 weiter zu erbringenden Einsparungen in Höhe von 40 Mio. DM wären schlechterdings nicht leistbar gewesen, ohne nicht vertretbare Einschränkungen von Studium, Lehre und Forschung hinnehmen zu müssen. Bei diesen Gebühren handelt es sich jedoch nicht - wie in der politischen Diskussion mitunter fälschlich behauptet wird - um verkappte Studiengebühren. Dies mag man auch schon daran erkennen, daß die Gebührenhöhe von 100 DM pro Bearbeitungsakt und damit pro Semester für eine Studiengebühr in Anbetracht der tatsächlichen Kosten für einen Studienplatz geradezu lächerlich gering wäre.
Baden-Württemberg hat dieses Mittel gewählt, um allgemeine Studiengebühren zu vermeiden. Die Diskussion darüber wird sich allerdings nicht erübrigen. Man muß vor dem Hintergrund der Finanzsituation - die im übrigen alle Länder gleichermaßen trifft - zwischen dem hohen Gut der elternunabhängigen Förderung und kostenfreien Hochschulausbildung einerseits und der Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Hochschulen andererseits künftig genau abwägen. Tatsache ist, daß ein Hochschulstudium für den Absolventen in aller Regel wirtschaftlich lohnend ist. Ein Studienabschluß ermöglicht noch immer ein deutlich höheres Einkommen und bringt anderweitige Vorteile. Die Lasten der Hochschulfinanzierung werden aber von allen Steuerzahlern und dabei weit überwiegend von Nichtakademikern getragen. Bei weggebrochenen finanziellen Spielräumen ist es deshalb nur folgerichtig und im übrigen auch ein Akt der Solidarität, die Studierenden sehr moderat an der Finanzierung ihrer Ausbildung zu beteiligen. Denn nicht zuletzt dadurch wird den Hochschulen ermöglicht, Studium, Lehre und Forschung in Baden-Württemberg auf dem bewährt hohen Niveau weiterführen zu können.
(Red. mj/papa)
Klaus Staeck, Jahrgang 1938 und heimisch in der Heidelberger Ingrimstraße, gibt nicht auf. Als Künstler, Rechtsanwalt, Galerist und Politiker macht er weiterhin aufmerksam auf "den Schwindel, in dem wir leben”. Seine Plakate und Postkarten sind politische Massenkunst, populär geworden in den 70er Jahren. Die Zeiten haben sich geändert, doch Aufklärung, so hofft Staeck, hat noch eine Chance.
ruprecht: Herr Staeck, in Ihren Text-Bild-Montagen stellen Sie gesellschaftliche und politische Mißstände dar, nennen die Dinge in satirischer Übertreibung beim Namen. Was wollen Sie letztendlich mit Ihren Plakaten erreichen?
Staeck: Das Wort Denkanstöße ist immer die gebräuchlichste Bezeichnung für das, was ich mache. Es ist ein Gesprächsangebot, ein Angebot zur Diskussion über Themen, von denen ich glaube, daß sie nicht nur meine eigenen sind, sondern auch andere Menschen betreffen. Sie sind natürlich mit der Hoffnung gemacht, auch mithelfen zu können, die Zustände, die ich beschreibe, zu verändern. Das ist kein reiner Selbstzweck, daß da einer den Unmut, den er hat, in Bilder und Texte bringt, sondern ich habe neben dem künstlerischen auch einen direkt politischen Anspruch.
ruprecht: Es ist also Ihr Ziel, zu gesellschaftlicher Veränderung beizutragen. Inwieweit glauben Sie, ist das überhaupt möglich?
Staeck: Je älter man wird, um so geringer schätzt man die Möglichkeiten ein, Veränderung herbeizuführen. Am deutlichsten wird die Begrenztheit der Möglichkeiten, wenn man sich meine Umweltplakate anschaut. Die ersten habe ich vor fast 30 Jahren gemacht. Damals war das kein allgemeines Thema, sondern eher eins für Spezialisten. Inzwischen ist es für viele ein hautnahes Problem geworden. Aber wie man das Bewußtsein in Handlung umsetzt, also bewirkt, daß sich jeder einzelne nach den Möglichkeiten, die er hat, verhält - da wachsen meine Zweifel, wie man die Menschen erreicht. Nehmen Sie ein simples Beispiel, ein Plakat, das ich vor vier Jahren gemacht habe und das sich gegen den Mißbrauch dieses grünen Punktes wendet: "Der größte Schwindel nach der Farbe Grün.” Wenn man die nüchternen Zahlen nimmt: Es gibt heute mehr Dosen als vor dieser Verpackungsverordnung. Da sieht man, wie der Schwindel als allgemeines Element unseres Zusammenlebens zugenommen hat.
ruprecht: Ist es heute schwieriger, die Leute auf den "Schwindel”, auf Probleme und Mißstände aufmerksam zu machen als vor 20 Jahren?
Staeck: Es ist insofern schwieriger, als die Leute eine dickere Hornhaut bekommen haben und die Verdrängung perfekter funktioniert. Es gibt ja heute durch die Medien eine ganze Verdrängungsindustrie. Wenn die Leute den Schwindel als bezahlten Schwindel erkennen würden, wäre das ja nicht weiter gefährlich. Aber die Situation ist schon schlimm, gerade weil auch der Umgang der Leute untereinander unpolitischer geworden ist. Wir leben zwar, behaupte ich, in den politischsten Zeiten; zumindest in meiner Lebenszeit hat es kaum Zeiten gegeben, in denen sich so viele Dinge so radikal verändert haben wie im Augenblick. Und trotzdem nehmen relativ wenige Menschen an diesen Veränderungen gestaltend teil. Als am Tropf Hängende, da gibt es natürlich Millionen, aber die wirklich noch versuchen, ihre eigene Existenz zu beeinflussen, das werden immer weniger.
ruprecht: Bezieht sich das auch auf junge Leute?
Staeck: Meine Sorge ist, daß gerade die Jugend heute kaum noch Grundsatzfragen stellt. Was reitet junge Leute zum Beispiel, als wandelnde Reklamesäulen herumzulaufen? Was sich Herr Becker und Frau Graf teuer bezahlen lassen, machen viele heute ja freiwillig. Das hätten wir zu meiner Jugendzeit abgelehnt. Junge Leute kratzen heute nur noch ein bißchen an der Oberfläche, machen verrückte Sachen, die aber gleich einzuordnen sind: Chaostage, grün gefärbte Haare, Graffiti. Wenn ich sehe, daß jemand sein Namenskürzel auf jeder Hauswand hinterläßt, dann frage ich mich: "Was soll das? Was ist die Botschaft? Wenn Du mir was zu sagen hast, dann sage mir was!” So ein Satz wie "Anarchie ist machbar, Frau Nachbar” hat ja noch einen gewissen Witz, eine gewisse Botschaft. Aber nur wie Hunde an die Ecke pinkeln, um ihre Reviere abzustecken, das ist mir einfach zu wenig. Ich kann nur sagen: Freunde, wenn ihr aus dem Techno-Rausch oder was auch immer für einem Rausch erwacht, ihr werdet euch umschauen, was wir, die Alten, hinterlassen haben. Jugend muß letztlich auch immer die Alten wegschieben und sie, wenn sie zu maßlos werden, in ihre Schranken verweisen. Das war mein Modell während meiner Jugend. Da haben wir uns gegen die zur Wehr gesetzt, die unsere Ressourcen leichtfertig versuchten aufzubrauchen.
ruprecht: Wundert es Sie, wie wenig die Mehrheit der Studierenden gegen Studiengebühren protestiert?
Staeck: Naja, da kann man sagen: Nicht einmal in eigener Sache agieren sie noch, wofür denn dann? Aber ich will nicht pauschalisieren. Zu meiner Zeit hat es da auch ganz wenige Leute gegeben. Da waren an der Universität Heidelberg von 7000 Studenten vielleicht 20-30 irgendwie politisch engagiert. Als ich 1960 der SPD beitrat, war das etwas absolut Exotisches. Bei allem Lamento unterstütze ich immer alle, die etwas tun, so zum Beispiel den Boykott-Aufruf gegen Einschreibegebühren.
ruprecht: Läßt Sie die heute vorherrschende Politikverdrossenheit nicht resignieren?
Staeck: Nein, ich gehöre, wie ich immer sage, zu den ApfelbäumchenLeuten - nach dem Lutherwort "Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen.” Von Verdrossenheit keine Spur, eher von offensivem Zorn. Ich bin jemand, der dann bestimmte Dinge um so mehr anmahnt, vielleicht auch einen Ton schärfer wird, jemand, der dann versucht, seine Kräfte zu verdoppeln.
ruprecht: Sie engagieren sich seit über 25 Jahren aktiv in der SPD. Was motiviert Sie dazu?
Staeck: Ich habe immer auch die Grenzen meiner künstlerischen Arbeit, glaube ich, ganz richtig eingeschätzt. Habe erkannt, daß ohne jemand, der das politisch umsetzt, was man da fordert, nichts zu bewegen ist. Deshalb habe ich mich sehr früh um politische Anbindung bemüht, was nicht bedeutet, daß ich auch nur eine Minute sowas wie ein Parteigraphiker werden wollte. Indem ich mich mehr mit Politik befaßte, habe ich nach dem berühmten Hebel gesucht, mit dem man aus der Kunst heraus am besten etwas bewegt. Das ist nicht unbedingt eine sehr positive Erfahrung. Die Kunst ist ja etwas, wo der Kompromiß eher verpönt ist. In der demokratisch organisierten Politik ist ein guter Kompromiß, der möglichst alle Seiten befriedigt, das höchste der Gefühle. Also gibt es da schon einen fundamentalen Unterschied. Ich halte aber nichts von den Klugscheißern, die immer nur die Politik für alle Mißstände dieser Welt verantwortlich machen, sich selber aber ständig frei stellen von jeder Verantwortung. Also mein Prinzip ist nicht nur das Prinzip Hoffnung, sondern auch das Prinzip Verantwortung.
ruprecht: Und das setzen sie auch bei anderen voraus?
Staeck: Nein, freiwillig etwas für andere zu tun, entspricht nicht unbedingt dem menschlichen Wesen, das muß man deutlich sehen. Und das bedeutet auch für einen selber immer wieder die Frage: Macht das jetzt einen Sinn? Ich frage nicht, soll ich jetzt resignieren oder nicht? Aber die Sorge, die mich zusehends beschäftigt, ist, ob Leute, die wie ich immer wieder versuchen, anderen Mut zu machen, an der Veränderung dran zu bleiben. Daß die nicht möglicherweise auch Schwindler sind, indem sie den Leuten suggerieren "Jawohl, da gibt's noch 'ne Möglichkeit”. Obwohl es in manchen Umweltbereichen zum Beispiel kaum noch eine Möglichkeit gibt, weil sämtliche Entwicklungen in die Gegenrichtung laufen. Wieviele Umweltkonferenzen haben wir in letzter Zeit gehabt, und was ist dann dabei rausgekommen, außer daß die, die dahin gereist sind, die Umwelt noch mehr belastet haben?
ruprecht: Fühlen Sie sich als Kritiker in der Öffentlichkeit verstanden?
Staeck: Das Dilemma ist, daß eigentlich ja keine richtige Debatte mehr stattfindet, sondern daß jeder, der Zweifel einräumt, gleich denunziert wird. Jemandem, der fragt "Ja, muß das denn sein, muß denn ein Fußballstar immer mehr verdient und ein Arbeiter immer weniger?”, dem wird gleich unterstellt, er wolle eine Neid-Debatte führen. Da braucht man manchmal ein ganz schön dickes Fell, um trotzdem noch weiterzumachen. Ich höre oft den Satz "Das ist 70er Jahre”, was ich mache. Als ob Aufklärung obsolet geworden wäre. Ich glaube, sie ist dringender als je zuvor gefordert.
ruprecht: Aber ist es nicht so, daß die Leute heute, gerade was die Umweltproblematik angeht, eigentlich sehr gut informiert sind?
Staeck: Der Unterschied zu damals ist: Wir wissen, was wir anrichten. Das Ozon-Loch ist ja keine Fiktion, das ist Realität. Wir wissen es und ziehen trotzdem kaum Konsequenzen außer so kleinen kosmetischen Dingen. Wir haben unseren Eltern Vorwürfe gemacht, warum sie die Nazis so ohne weiteres geduldet, unterstützt, ertragen haben. Ich kann mir vorstellen, daß die nächste Generation - wenn sie dazu trotz zuviel Blei im Blut noch in der Lage ist - auch Vorwürfe macht. Darauf muß man heute aufmerksam machen, und viel mehr kann man nicht machen. Ich habe ja keine Armee oder Jurisdiktionsgewalt. Aber ich glaube schon, daß sich die Menschen unter dem Druck der Verhältnisse wieder erinnern müssen, daß man seine eigenen Lebensverhältnisse mitgestalten muß. Ich denke, daß Aufklärung notwendig ist und hoffentlich auch noch eine Chance hat.
ruprecht: Im Vordergrund Ihrer künstlerischen Arbeit steht also offensichtlich die politische Aussage. Wird dadurch der künstlerische Anspruch nicht automatisch zurückgedrängt?
Staeck: Nein. Ich habe immer das Politische und das Künstlerische gleichwertig behandelt. Ich habe nie auf eine künstlerische Aussage zugunsten des Politischen verzichtet.
ruprecht: Steht die Ästhetik der politischen Kunst nicht manchmal im Wege?
Staeck: Das Ästhetische spielt natürlich eine Rolle, aber ich unterliege nicht der Diktatur des Ästhetischen. Meine Kunst besteht darin, das Künstlerische und das Politische in der Waage zu halten, so daß nicht das eine das andere völlig erschlägt. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich mich ja kaum von einer normalen Werbeagentur unterscheiden. Deshalb bin ich auch ein Störfaktor. Für mich ist Kunst etwas, was die allgemeine Behaglichkeit, die Verdrängung und die Zerstörung stört.
ruprecht: Würden Sie sagen, die Funktion jeder Kunst sollte aufklärerischer Art sein?
Staeck: Ich würde nicht diesen absoluten Anspruch erheben, daß jede Kunst aufklären muß. Wenn jemand der Meinung ist, durch Formexperimente das ästhetische Empfinden der Leute beeinflussen zu können, ist das natürlich legitim. Ich meine nicht, daß alle Leute so arbeiten müssen wie ich. Aber ich habe nun mal diesen Anspruch. Ich habe keine Begabung zu Opportunismus. Das ist vielleicht Pech von der Veranlagung her. Einiges wäre anders einfacher. Aber ich habe auf diese Weise zumindest ein spannendes Leben. Mir sitzen viele, die sich durch mich gestört fühlen, immer im Nacken. Das hält lebendig.
(Interview: jb)
Was motiviert uns eigentlich zum Boykott der 100 Mark Verwaltungsgebühren? Zwei Fraktionen scheint es unter Studierenden zu geben. Sie finden freilich in einem entscheidenden Punkt zusammen. Die einen boykottieren die Gebühr nur, weil sie nicht an die Universitäten geht, sondern direkt an das Land. Sie finden aber durchaus, daß Studierenden mithelfen sollen, die Finanznöte der Universitäten lindern: Die Gesellschaft gibt uns die Chance zu einer überdurchschnittlichen Bildung; und da die meisten Studis es sich leisten können, 100 DM pro Semester aufzubringen, sollten sie, so diese Position, zur Finanzierung beitragen, so wie alle Teile der Bevölkerung zur Finanzierung des Sozialstaates beitragen müssen.
Die andere Fraktion lehnt diese "Studiensteuer” völlig ab: Sie versteht Bildung als Wissensvermittlung jenseits von marktwirtschaftlichen Kriterien, als das eigentliche Kapital einer Gesellschaft. Opfern wir dieses Ideal auf dem Altar wirtschaftlicher Interessen, stellen wir unsere Schulzeit, unsere Ausbildung, unseren Beruf und damit einen Großteil unseres Lebens unter das Primat der Wirtschaftlichkeit.
100 Mark Verwaltungs- und bald noch mehr Studiengebühren sind in dieser Entwicklung natürlich nur ein Schritt: Sie verdeutlichen aber, wie wenig Landes- wie Bundesregierung nicht nur Bildung, sondern auch soziale Sicherungssysteme als gesellschaftliche Aufgabe begreifen und die Last dafür jedem Einzelnen übertragen wollen. Der Staat zieht sich aus seiner Verantwortung zurück und zerstört dadurch die gesellschaftliche Solidarität.
So unterschiedlich diese beiden "Fraktionen” die Bedeutung der Verwaltungsgebühren einschätzen, in einem ist man sich doch einig: Die Einzahlung auf das Treuhandkonto und die Beteiligung an Demonstrationen müssen der Anfang einer breiten, dauerhaften studentischen Bewegung sein, die sich nicht nur gegen Kürzungen bei den eigenen Mitteln wehrt, sondern sich mit anderen Betroffenen willkürlicher Streichungen in allen gesellschaftlichen Bereichen solidarisiert und durch eine weitere Ausbreitung des Protestes der Politik klarmacht, daß sie sich nicht mehr im Einklang mit den Interessen einer Mehrheit der Bevölkerung befindet. Eine Regierung, die nicht mehr das Allgemeinwohl im Sinn hat, zehrt an der Grundlage unserer Demokratie, die bislang auf einem weitgehenden Konsens über bestimmte Werte beruhte.
Die Resolution, die von der letzten studentischen Vollversammlung verabschiedet wurde, spricht eine deutliche Sprache: "Die Politik des sozialen Kahlschlags (...) an der Hochschule (...) ist ein weiterer Baustein in der Demontage des Sozialstaats, die fortgeführt werden wird, solange wir keinen (...)Widerstand entgegensetzen und uns auf fruchtlose Appelle an die herrschende Politik beschränken.” Wenn dieser Bezug auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung aber ein bloßes Lippenbekenntnisse bleibt und wir uns mit der Einrichtung des Treuhandkontos nur 100 Mark sparen wollen, dann wird die nächste Vollversammlung am 10. Februar nichts als ein mehr oder weniger aufsehenerregendes Requiem der Studierendenbewegung gewesen sein.
ruprecht: Das Thema Nummer Eins in Baden-Württemberg sind Studien- und Verwaltungsgebühren...
Ulmer: Und Sie meinen, die Verschlechterung der Studienbedingungen - die kürzeren Öffnungszeiten von Bibliotheken, die Unmöglichkeit notwendige Veranstaltungen anzubieten, das Leerbleiben von Lehrstühlen, das alles ist nicht die Nummer Eins?
ruprecht: Das hängt zusammen.
Ulmer: Nein, eben nicht. Denn indem man nicht einmal bereit ist, in relativ bescheidenem Umfang hier etwas beizutragen, verschärft man nur die Situation. Und ich möchte dazu klar sagen: Die vierzig Millionen, die das Land auf diese Weise einzunehmen beabsichtigt, kommen den Hochschulen zugute. Ich sehe durchaus, daß es einen Unterschied macht, ob man im Semester hundert Mark mehr oder weniger in der Tasche hat. Aber das Ganze ist auch ein Abwägungsproblem.
ruprecht: Auf der Demo Ende November äußerten Sie, daß Sie auch nicht ganz glücklich über die Einschreibegebühren von100 Mark sind.
Ulmer: Das trifft zu. Das habe ich bei mehreren Gelegenheiten gesagt. Nur muß ich auch sagen, daß diese Einschreibegebühren bezogen auf die finanzielle Lage der Universitäten dann doch besser als nichts sind. Was mich an den Einschreibegebühren ärgert, sind zwei Punkte: Das eine ist, daß wir hier Geld kassieren für etwas, das eine absolute Nebensache ist. Ich weiß nicht, wie lange man in der Zentralen Universitätsverwaltung für eine einmalige Rückmeldung braucht, sicher nicht soviel wie hundert Mark in Arbeitsstunden umgerechnet ergeben. Zweitens, daß es keine soziale Differenzierung gibt. Ich halte von daher diesen Ansatz für falsch: wenn die Universität Gebühren erhebt, dann bestimmt nicht für die Verwaltungsleistungen.
ruprecht: Die Kooperation von Treuhand-AK und Univerwaltung bei der Verschickung von Überweisungsformularen und Infozetteln ist mißlungen. Wie sehen Sie das?
Ulmer: Da gibt es zwei Gründe. Das eine ist die Frage, wie ein Rektorat glaubwürdig auftreten kann. Wenn wir, was wir massiv tun, gegenüber der Landesregierung darauf hinweisen, daß die Art und Weise und das Ausmaß der Kürzungen uns in eine ganz kritische Lage bringen und wir gleichzeitig uns gegenüber der Landesregierung dagegen aussprechen würden, daß nun mit den Einschreibegebühren ein Teil abgefangen wird, würde man uns fragen, was wir eigentlich wollen. So gesehen muß ich auch einräumen: Die Einschreibegebühren sind besser als nichts - deswegen sind sie nicht gut. Das Zweite ist: Sie wissen, daß Rektoren, ebenso wie Professoren, Beamte sind. Beamte sind unter anderem verpflichtet, das geltende Recht zu respektieren und umzusetzen.
ruprecht: Es ist aber auffällig, daß die Verwaltung dem Treuhand-AK zunächst zusagt, die Adressen zur Verfügung zu stellen und erst im letzten Moment die endgültige Absage erteilt.
Ulmer: Ich glaube, daß Sie da von einem falschen Sachverhalt ausgehen. Noch vor der Vollversammlung hatten wir zugesagt, daß wir von der Universitätsspitze aus die Frage, was passiert, wenn die Einschreibegebühren nicht gezahlt werden, nicht besonders offensiv angehen werden. Wir müssen dann irgendwann mahnen, aber wann dann als Konsequenz die Exmatrikulation eintritt - das würden wir von uns aus nicht forcieren.
ruprecht: Aber sobald es um Boykott geht, gibt es keine Kooperation.
Ulmer: Da können wir nicht entgegenkommen.
ruprecht: Ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, daß darauf gebaut wird, daß die meisten Studierenden - leider - nicht besonders gut informiert sind, wie ihre Möglichkeiten bezüglich des Treuhandkontos sind, und hier eine Verunsicherungstaktik bezüglich dem Exmatrikulationsablauf gefahren wird.
Ulmer: Wir sind auch nicht daran interessiert, scharenweise Studenten zu exmatrikulieren. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, daß wir durch einen Erlaß aus Stuttgart angewiesen werden, die Mahnung herauszuschicken. Da wir insoweit weisungsgebunden sind, müssen wir dann die Mahnung verschicken. Die Konsequenz ist, daß die Exmatrikulation unvermeidlich ist. Deswegen weisen wir darauf hin: Sie müssen mit der Mahnung rechnen. Aber wir hüten uns, einen bestimmten Zeitpunkt zu nennen. Sie müssen unsere Situation sehen.
Es gibt zur Zeit so viele ganz massive Gefahren für die Universität, die sich im Millionenbereich bewegen, daß es mir etwas schwer fällt, die große Aufregung um die Einschreibegebühren zu verstehen und dabei zu sehen, daß das die Gesamtlage nicht interessiert oder erst dann zu interessieren beginnt, wenn man etwas in der eigenen Tasche spürt. Man müßte ein bißchen mehr Gemeinsinn zeigen. Das vermisse ich hier stark.
ruprecht: Halten Sie den Protest der Studierenden für berechtigt?
Ulmer: Da will ich die Gegenfrage stellen: Haben Sie auch nur irgendeine Bevölkerungsgruppe gefunden, die, wenn es darum geht, etwas zu erheben oder etwas abzuziehen, nicht protestiert hat?
ruprecht: Sie haben vollkommen recht, daß jede Gruppe der Gesellschaft bei plötzlichen Kürzungen anfängt zu schreien. Doch bei uns Studierenden sehe ich einen anderen Umstand: Es ist schwer verständlich, warum ich etwas zahlen soll, wenn sich zugleich die Studienbedingungen verschlechtern.
Ulmer: Dem stimme ich voll zu. In der Erklärung zur Frage der Studiengebühren, die wir vor zwei Jahren auf LRK-Ebene beschlossen haben, ist nachzulesen, daß wir damals der Meinung waren, daß die Studienbedingungen nicht so gut sind wie sie hätten sein können. Heute würde ich sagen, daß ich froh wäre, wenn ich die Studiengebühren hätte, um wenigstens das vorherige Niveau zu halten. Ihre Argumentation: "Es wird alles schlechter und jetzt soll ich auch noch dafür zahlen” ist völlig überzeugend. Ich habe vor ein paar Monaten, als wir ein Gespräch mit dem Finanzminister hatten, ihn gefragt, was er denn, wenn es tausend Mark Studiengebühren gäbe, damit machen würde. Denn natürlich ist der Verdacht vorhanden, daß der Staat kassiert und die Hochschulen am Ende nichts davon abkriegen. Er hat zweimal erwidert, daß diese Gebühren den Universitäten zufließen würden. (Interview: gan, papa)
Wer nicht fragt, bleibt dumm - oder bekommt keine Gäste. Das jedenfalls befürchtete das Studentenwerk und startete letztes Jahr im Juni eine Umfrage in den Heidelberger Mensen. Daß erst jetzt etwas darüber zu lesen ist, liegt nicht etwa an unausgeschlafenen ruprecht-Redakteuren, sondern daran, daß die Auswertung der Umfrage so lange dauerte.
Man hatte nämlich Fragebögen erstellt, zu denen man kein Computerprogramm besaß, das die Antworten auswerten konnte. So mußte die ganze Arbeit in unzähligen Stunden von Hand gemacht werden. "Bei der nächsten Umfrage, die voraussichtlich Anfang des Sommersemesters stattfinden wird, werden wir aber vorher dafür sorgen, daß wir eine EDV-Auswertung haben”, versichert Ulrike Leiblein, stellvertretende Geschäftsführerin des Studentenwerks. In Zukunft will man dann auch mindestens einmal jährlich die Studierenden nach ihrer Meinung befragen, um deren Wünschen besser gerecht zu werden.
Schon früher mußte sich das Studentenwerk ab und zu mal sagen lassen, daß die Spaghetti zu matschig und die Kartoffeln zu kalt seien, doch so richtig aufgeschreckt wurden die Verantwortlichen erst durch das Focus-Ranking aller deutschen Hochschulen, bei dem die Heidelberger Mensa nicht gerade glanzvoll abschnitt. Als dann Ende 1995 die Zahlen der ausgegebenen Essen in den Keller rutschten, war klar: Hier muß etwas passieren.
Den Anfang machten die legendären Gummihandschuhe; sie verschwanden kurzerhand, da es so manchem beim Anblick eines Kautschuk-Fingers in seinen Nudeln den Appetit verschlug. Ein weiteres, altgedientes Requisit der Studentenküche, das Blech-Tablett, mußte nun auch Abschied von uns nehmen; das moderne Ornamin-Tablett hielt statt dessen Einzug in die Altstadt, und sorgt außerdem dafür, daß das aufgetischte Mahl nicht so schnell kalt wird. Doch alles hat seinen Preis: Für eines der neuen Tabletts mußte das Studentenwerk immerhin 30,- DM hinlegen, und wird sie wahrscheinlich nach ca. fünf Jahren auch schon wieder wegwerfen können, während die alten Alu-Tabletts nahezu unverwüstlich waren - bei einer Lebensdauer von insgesamt vierzig Jahren, verdoppelt durch eine zwischenzeitliche Auffrischung in der Metallpresse, konnten sogar mehrere Generationen vom selben Tablett essen.
Aber wenn schon Erneuerungen, warum dann nicht gleich richtiges Geschirr, wie im Neuenheimer Feld? "Dazu bräuchten wir leider andere Spülmaschinen, für die schlicht kein Platz da ist”, erklärt der zuständige Bearbeiter vom Studentenwerk, dem inzwischen die Auswertung der Umfrage übertragen wurde. "Und ein Umbau wäre nicht nur ungeheuer kostspielig, sondern auch sehr schwer zu realisieren, da die Gebäude und Grundstücke dem Land gehören und man erst einmal eine Genehmigung bekommen müßte.”
Insgesamt hat man schon etwas bewirkt mit den vielen kleinen "Mensa-Reformen”, die inzwischen stattgefunden haben. Die tausend ausgewerteten Antwortbögen verraten nämlich, daß die Mehrheit der hungrigen Masse zufriedener geworden ist - obwohl sich die verteilten Noten immer noch im Mittelbereich bewegen und ein wenig von Mensa zu Mensa schwanken. Während z.B. die Qualität und das Ambiente in der Zentralmensa im Feld am höchsten und im Marstall am niedrigsten zu sein scheinen, verhält es sich bei der Portionsgröße genau umgekehrt.
Sind die Mitarbeiterinnen in der Altstadt etwa freigebiger, oder haben Naturwissenschaftler einfach mehr Hunger? Fest steht, daß die Einführung des Komponentenessens ein Erfolg war. Im Zusammenhang damit wurde auch die Portionsgröße besser bewertet als zuvor: Zwar werden die besonders Hungrigen immer noch nicht satt, doch die Mehrheit ist zufrieden. Die Mensa Italiana kam anfangs in der Marstall-Mensa sehr gut an; nachdem sie nun jedoch auch in den anderen Mensen angeboten wird, ist die Nachfrage gesunken. Dafür mußte ein deutscher Stammgast vom Speiseplan weichen: Den Eintopf verlangten nur noch 200 bis 300 Personen pro Tag, so daß sich das Gemüse-Putzen dafür nicht mehr lohnte.
Allerdings hat es die Heidelberger Mensa auch schwerer als andere, da die Freßmeile Hauptstraße viele vom großen Topf weglockt. "Wenn da wieder ein neuer Kebap-Laden aufgemacht hat, verkaufen wir gleich ein paar hundert Essen weniger”, beklagt das Studentenwerk. Während z. B. Freiburg oder Tübingen 30 bis 33 % der Studierenden per Mensa verköstigt, liegt dieser Anteil in Heidelberg nicht über 23 %.
Aber das Studentenwerk bemüht sich fleißig weiter. Auf einen Punkt legt man besonderen Wert: Die Freundlichkeit der Angestellten. 1996 wurde deshalb das "Jahr der Freundlichkeit” ausgerufen, denn viele der überwiegend türkischen Mitarbeiterinnen, die oft kaum Deutsch sprechen, seien noch der Meinung, "die Studenten sollen froh sein, wenn sie überhaupt etwas zu essen bekommen.” Um dies zu ändern, wird jetzt ein Wanderpreis ausgegeben, der den Wettbewerb unter den Heidelberger Mensen beleben soll. Die nächste Umfrage wird zeigen, ob diese Bemühungen des Studentenwerks Erfolg haben. (gz)
Blaue Leuchtschrift kündet von einer Neueinrichtung des Studentenwerkes: Das Info-Center in der Triplexmensa läßt sich kaum übersehen. Seit dem 17. Januar ist das Studentenwerk direkt am Uniplatz präsent und bietet seine Dienste in noch zentralerer Lage an als bisher.
Vorteil: Auch Erstsemester und neuangekommene ausländische Studierende finden ohne langes Suchen einen Ansprechpartner. Das neue Info-Center dient als erste Anlauf- und Informationsstelle. Hier können Auskünfte über die Leistungen und Angebote des Studentenwerks eingeholt, Antragsformulare abgeholt und eingereicht und beispielsweise Diebstahl- und Unfallversicherungen sowie Mietverträge abgeschlossen werden.
Auch BAföG-Angelegenheiten kann man jetzt auf dem Weg in die Mensa erledigen. Im behindertengerecht gestalteten Info-Center ist man darauf vorbereitet, Anträge und Bescheinigungen anzunehmen und an die jeweiligen Sachbearbeiter weiterzuleiten, kurze Fragen zu beantworten und auch eben mal schnell auszurechnen, ob sich ein BAföG-Antrag überhaupt lohnt. Langes Warten in vollen Sprechstunden, nur um Kleinigkeiten zu erledigen, entfällt also künftig ebenso wie das zeitraubende Suchen nach dem richtigen Ansprechpartner in den verschiedenen Gebäuden, Stockwerken und Büros im Marstall. Nur für kompliziertere oder vertrauliche Angelegenheiten muß man den Weg noch zurücklegen.
Komplett in das neue Info-Center umgezogen ist die Zimmervermittlung. Diese Verlegung war laut Studentenwerk nötig geworden, weil die Flut von Besuchern und Anrufern im früheren Büro nicht mehr zu bewältigen war. Dort werden jetzt ausschließlich die Zimmer- und Wohnungsangebote telefonisch angenommen und erfaßt. Ein eindeutiges Mehr an Service für die Studierenden ergibt sich auch durch die längeren Öffnungszeiten: Das Info-Center ist täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr besetzt.
Übrigens wurden sämtliche Um- und Einbauten in der Triplexmensa vom Universitätsbauamt geleistet und somit nicht vom Studentenwerk finanziert. Außerdem wird das Info-Center ohne zusätzliches Personal betrieben. Diese Neueinrichtung bringt also für die Studierenden mehr Service, ohne Kosten zu verursachen. Na, darüber freut man sich doch in Zeiten von Sparmaßnahmen und Kürzungen besonders! (jb)
Informationen aus schneller Hand: der Info-Stand in der Triplex
In der von Sparmaßnahmen besonders hart getroffenen Universitätsbibliothek weiß man sich nicht mehr anders zu helfen: Die Öffnungszeiten werden drastisch eingeschränkt.
In der Altstadt macht die UB ab 17. Februar künftig um 20.00 Uhr zu - also drei Stunden früher als bisher. Samstag ist nur noch bis drei Uhr nachmittags geöffnet, was bedeutet, daß sie ihre Tore demnächst ganze vier Stunden früher als bisher dichtmacht. Im Neuenheimer Feld schließt die Bilbliothek montags bis freitags schon um 19.00 Uhr, das ist eine Stunde früher, samstags hat sie ganz geschlossen.
Die Ausstellungen in der Altstadt, die von Frühjahr bis Herbst auch sonn- und feiertags geöffnet waren, werden den Studierenden an diesen Tagen auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Bibliotheksdirektor Hermann Dörpingshaus begründete die harten Schnitte damit, daß der UB 100.000 Mark an Hilfskraftmitteln - 34,9 % insgesamt - gestrichen worden seien. Bis zu acht UB-Hiwis werden auf der Straße landen. Die Aufsichten durch Einschränkung beim Bücherkauf zu halten, verbiete sich, weil man in dieser Sparte ohnehin schon 500.000 Mark habe einsparen müssen.
"Damit fallen wir auf das Niveau anderer Landesbibliotheken zurück”, bedauert Dörpinghaus. Doch deren schlechtes Beispiel könne nicht Anlaß sein, sich mit diesen Öffnungszeiten zufriedenzugeben. Sachlich sei es allemal gerechtfertigt, bis 23 Uhr zu öffnen, da nach internen Statistiken die Bibliothek zu dieser Zeit relativ hoch frequentiert wird; gleiches gelte für den Samstag. Auch der neuerlich beschnittene Literaturetat ist nicht mehr der Rede wert: Hier werde, so Dörpinghaus, Heidelberg von vornherein um 350.000 DM im Haushaltsplan beschnitten, dazu kommen noch die eingangs erwähnten 500.000 DM und die Kürzung von Sondermitteln für Literatur.
Insgesamt summieren sich laut Direktor Dörpinghaus die Kürzungen an der Universitätsbibliothek auf etwa eine Million DM. Dadurch sei selbst der Grundbedarf nicht mehr zu decken. Besonders hart trifft es den Bereich der Fachzeitschriften, die Medizin und die Naturwissenschaften. Ebenso werden einige CD-ROMDatenbanken, die nicht so oft genutzt werden, nicht weitergeführt. Einzig bei den Lehrbüchern wird es keine so dramatischen Kürzungen geben, da Heidelberg in diesem Bereich eine Sonderstellung einimmt, die sogar dazu führe, daß Studierende aus Frankfurt wegen eines Buches angereist kommen.
Daß die Situation ernst ist, zeigt auch die neuste Ausgabe des "Unispiegel”. Demnach bietet die Unibibliothek Sponsoren Werbeflächen, u.a. auf den Rückseiten von Ausleihzetteln und Friststreifen, an, die Lesesäle sollen plakatiert und die "Vitrinen kommerziell genutzt werden”. Immerhin: Die Außenfassade soll reklamefrei bleiben. (mj)
Ruhig war es um die Studi-Liste geworden. Im Sommer 1994 angetreten, die studentischen Interessen im Heidelberger Gemeinderat zu vertreten, errang sie auf Anhieb mit Jutta Göttert einen Sitz und setzte mit Studiticket, Karlstorbahnhof, dem Ausbau des Nahverkehrs sowie der Anlegung von Radwegen sogar einige ihrer Ziele durch.
Mit der Beschaulichkeit war es vorbei, als die Studi-Liste kürzlich mit den bürgerlichen Ratsfraktionen gemeinsame Sache machte und gegen SPD und GAL den Haushaltsplan '97 ablehnte. Dieser Schritt stieß nicht nur bei der FSK, aus der die Studi-Liste seinerzeit hervorgegangen war, auf Unverständnis. Auch andere Vertreter des linken Spektrums zeigten sich verschnupft. Während etwa die GAL grundsätzlich ihr weiterhin positives Verhältnis zur Studi-Liste betont, sehen einzelne ihrer Abgeordneten die Liste schon in einem "Rechtsbündnis”, das bislang abgelehnten Anträgen der CDU, die radikale Kürzungen im Kultur-, Sozial- und Umweltbereich vorsehen, doch noch zur Mehrheit verhelfen könnte. Ähnlich klingen auch die Vorwürfe der Juso-Hochschulgruppe: Göttert betreibe eine "Blockadepolitik” ganz im Stile von CDU und FDP.
Ratsfrau Göttert kontert die Kritik unter Verweis auf die Sachzwänge: Eine Haushaltspolitik nach der Devise "Weiter so” habe keine Perspektive und würde Heidelberg "mittelfristig in die Zahlungsunfähigkeit führen”. Die Studi-Liste wolle durch "differenzierte Kürzungen” in allen Bereichen Spielraum für Sozialarbeit und Kulturprojekte gewinnen. Die Oberbürgermeisterin könne bis zur Verabschiedung eines Haushaltes über 80% der Mittel des Vorjahres frei verfügen, und den von der CDU geforderten einseitigen Kürzungen werde die Studi-Liste "niemals zustimmen”.
Als die FSK Göttert und Mitstreiter Christian Weiss jüngst zu einem Gespräch einlud, wurde deutlich, wieso der Kontakt zwischen Studi-Liste und Studi-Vertretung in letzter Zeit immer magerer wurde: Die komplexen Inhalte der Stadtratsdebatten gehen über studentische Interessen hinaus und sind zudem schwer nachvollziehbar. So herrschen zunehmendes Desinteresse auf der einen und Enttäuschung auf der anderen Seite, Gerüchte über die Auflösung der Studi-Liste werden lauter.
Davon will Weiss, Gründer und Veteran der Liste, nichts wissen; es gebe weiterhin Treffen der Gruppe, zu der noch Verkehrsexperte Felix Berschin und zwei weitere Bezirksbeiräte gehören. Wie es nach 1998 mit dem Projekt weitergeht, stehe aber noch in den Sternen. Themen für einen weiteren Anlauf wie eine Straßenbahnlinie ins Neuenheimer Feld oder Ersatz für das Autonome Zentrum, gäbe es genug. Wichtig werde sein, die Sympathisanten wieder zu aktivieren: "Da werden wir uns selbst in den Arsch treten müssen”, so Göttert. Ein gezielter Wahlkampf an der Uni sei geplant, sei es für eine Studi-Liste oder eine Listenverbindung.
Auf jeden Fall muß für die nötige Zukunftsvorsorge der Kontakt zur Fachschaftskonferenz wiederhergestellt werden. "Ich war ziemlich enttäuscht von den Abenden, an denen ich in der FSK war, weil ich kein Feedback verspürte und die Leute lieber nach Hause wollten”, klagt Göttert. Die Ernüchterung war mit Sicherheit beidseitig. (mj,kh)
Wenn massive Einschränkungen durch begrenzte finanzielle Möglichkeiten erforderlich werden, sind nicht selten diejenigen davon betroffen, die sich am wenigsten dagegen wehren können. Die Allgemeine Sprachwissenschaft befindet sich schon seit Jahren in einer unerfreulichen Situation, jetzt droht ihr das endgültige Aus in Heidelberg.
Doch liegt die Ursache hierfür keineswegs nur darin begründet, daß die Allgemeine Sprachwissenschaft mit 100 Studenten eines der kleinsten Fächer an der Universität darstellt. Denn andere Fächer wie etwa die Ägyptologie müssen um ihr Fortbestehen nicht bangen, wenn sie wie in diesem Fall mit Herrn Aßmann einen Gelehrten mit weltweiter Anerkennung in ihren Kreisen hat. In der Sprachwissenschaft hingegen ist die einzige C4-Professur seit Jahren vakant. Nachdem der vorherige, wenig charismatische Amtsinhaber verstorben war, wurde zwar ein Neuberufungsverfahren eingeleitet, doch trotz zahlreicher Bewerbungen wurde durch Streitigkeiten innerhalb der Neuphilologischen Fakultät eine Neubesetzung der Professur verhindert. Dafür gibt es mehrere Gründe: Zum einen ist die Anglistik daran interessiert, den Lehrstuhl in ihren Bereich einzugliedern, zum anderen gibt es innerhalb der Germanistik ein reges Interesse an der Bibliothek des sprachwissenschaftlichen Seminars. Selbst wenn man diese nicht geheim gehaltenen Interessen nicht in seine Überlegungen miteinbezieht, so muß auf jeden Fall ein verbreitetes Desinteresse an der Erhaltung dieses Faches konstatiert werden.
Die Folge ist ein schleichender Verfall mit fatalen Folgen für die Studierenden. Nachdem zwei Jahre lang eine Vertretung der C4-Professur bewilligt wurde, ist jetzt angesichts der knappen Haushaltskasse selbst diese Vertretung gestrichen worden. An deren Stelle treten vorläufig billigere Lehraufträge, doch könnte schon bald die Auflösung des Fachs dieses weitere Provisorium beenden. Geht es nach dem Willen der Fakultät, so verschwindet das Seminar ganz, der vakante Lehrstuhl wird in die Anglistik eingegliedert. Die einzige Instanz, die das auf Universitätsebene noch verhindern kann, ist der Senat.
Frau Dr.Anschütz, Dozentin am Seminar, äußert Verständnis für die schwierige finanzielle Situation der Universität. Aber die Anzahl der Studenten als Bemessungsgrundlage für die Wichtigkeit eines Fachs sei einseitig: "Die Allgemeine Sprachwissenschaft ist wichtig für das Profil einer so großen Universität wie Heidelberg. Sie stellt ein zentrales Bindeglied zwischen den Fächern der Neuphilologischen Fakultät dar.” Zugleich sieht sie die mangelnde Lobby ihres Faches: "Es besteht ein starkes Machtgefälle zwischen den einzelnen Fächern der Fakultät.” Ein wichtiger Grund für die derzeitige Misere ihres Fachs stelle die versäumte Neuberufung einer angesehenen Professorin dar.
Man darf gespannt und skeptisch sein, ob die von der Fakultät beschlossene Abschaffung des Fachs vom Senat gestoppt wird. Doch schon jetzt ist klar, daß kleine Fächer mit geringer Lobby und fehlender Reputation der Lehrstuhlinhaber es angesichts immer geringerer finanzieller Handlungsspielräume der Universität künftig sehr schwer haben werden, ihre Existenz an der Universität zu behaupten. (papa)
Über die Situation am Institut für Allgemeine Sprachwissenschaft sprach ruprecht mit den Studierenden-Vertretern Sven Zimmermann, Sebastian Schmitt-Köppler (Allg. Sprachwissenschaft) und Douglas Fear (Indogermanistik).
ruprecht: Fühlt ihr euch von der Uni in bezug auf die Versprechungen der letzten Jahre hintergangen?
Sven: Im Grunde nicht. Wir haben ohnehin an keinerlei Versprechungen geglaubt. Wir sehen uns absichtsvoll hintergangen. Die Neubesetzung wurde bewußt verhindert. Von den sechs Bewerbungsvorträgen im Februar '96 war zumindest der einer Bewerberin sehr gut. Sie war bereit zu kommen. Durch Differenzen zwischen Berufungsrat, Fakultätsrat und Senat wurde die Berufungsliste abgelehnt.
Douglas: Hinzu kommt, daß auch die Indogermanistik davon Schaden nimmt. Die Besetzung der C3-Professur dort war gekoppelt an die C4-Stelle hier.
ruprecht: Was haltet ihr von der Behauptung, die nicht gesunkene Anzahl der Studierenden seit der Vakanz der C4-Professur spreche nicht für ein gezieltes Kleinschrumpfen?
Sven: Daß die Zahlen nicht gesunken sind, spricht für die Attraktivität des Faches, unabhängig davon, wie die Qualität der Lehre ist und wie sie aufrechterhalten werden kann.
ruprecht: Heißt das, daß an anderen Unis mit intaktem Lehrbetrieb die Zahlen der Studierenden ansteigen?
Sebastian: Genau das ist der Fall. In Städten wie Köln, Bonn und anderen ist die Zahl in den letzten Jahren gestiegen.
Sven: Die Allgemeine Sprachwissenschaft ist ein sehr junges Fach und global gesehen ein aufsteigendes. Es hat Verbindungen zu fast allen anderen Fächern, zur Medizin und Psychologie ebenso wie zur Informatik.Die Sprachwissenschaft nähert sich insgesamt einer allgemeinen Kognitionswissenschaft.
ruprecht: Wie gut ist die Quote bei den Abschlüssen?
Sebastian: Besser als beispielsweise bei den Germanisten. Ich möchte es übrigens nicht versäumen, darauf hinzuweisen, daß es Firmen hier in der Nähe von Heidelberg gibt, die an dem Fach und ihren Absolventen interessiert sind. Beispielsweise IBM, SAS oder SAP.
ruprecht: Kann noch von einem geregelten Lehrbetrieb gesprochen werden, wenn nun auch die Vertretung der C4-Stelle gestrichen wird?
Sebastian: Ein Lehrbetrieb kann im Moment nur durch Lehraufträge gewährleistet werden. Das Besondere daran im Vergleich zu anderen Fächern ist, daß diese Lehrveranstaltungen nicht nur kostenlos abgehalten werden, es sind Studierende höheren Semesters, die dies tun.
ruprecht: Unter welchen Bedingungen hat das Fach noch eine Chance?
Sven: Sollte die Stelle hier jemals wieder besetzt werden, dann wird ein Institut entstehen, das eine enorme Wichtigkeit haben wird: Als Grundlagenforschungsinstitut und auch als Zuträger für andere Fächer.
(Interview: papa)
Das Telefon klingelt. In der Weststadt, in der Altstadt. In Kirchheim, in Bergheim. Wenig später machen sich ein paar Gestalten auf den Weg zu ziemlich unwirtlichen Stellen der Region. Zu Weichenstellwerken bei Bruchsal, auf abgelegene Bahnhofsgleise bei Heidelberg, in die Nähe von gut geschützten Verladekränen bei Philippsburg.
Wenn irgendwo in Süddeutschland Atomtransporte auf den Weg gebracht werden sollen, wissen sie es bald, die Aktivisten der Heidelberger "Castorgruppe”. Und sie begleiten die Transporte fürsorglich mit Demonstrationen und Sitzblockaden und anderen direkten Aktionen.
Sie wehren sich gegen das Verschicken von Atommüll in Wiederaufbereitungsanlagen und Endlager, weil sie nicht glauben, daß man das verstrahlte Material sicher entsorgen kann. Und weil sie hoffen, daß einem Staat und einer Industrie, die ihre Strahlenabfälle nicht loswerden, eines Tages die Lust am Atomstrom ganz vergeht. Was man macht, ist nicht immer besonders legal, aber man hält es für legitim.
"Wir wollen Druck auf die Politik machen, der größer ist als den, welchen die Atomlobby ausübt”, sagt Heinz, ein Mitglied und Mitbegründer der Gruppe, die sich im Karlstorbahnhof trifft. Zudem "haben Atomtransporte nach Gorleben und das Eintreten dagegen auch symbolischen Wert, stehen für den gesamten Streit um die Nutzung der Kernenergie.” Das sehen nicht alle Atomkraftgegner so: Michael Sailer, der Kernkraft-Experte des Öko-Instituts, warnt vor einer einseitigen Fixierung auf die Transporte ins Endlager, weil er fürchtet, daß dies die Industrie in die gefährlichere, aber geräuschlosere Wiederaufbereitung treibt: Wenn sich um die Wiederaufbereitungstransporte nach Le Hague nur 30 statt 1000 Demonstranten kümmern, rollen sie halt dorthin.
Die Routen der Transporte stehen nicht gerade im Kursbuch der Bundesbahn. Woher kennen die Bahn-Blockierer sie trotzdem? "Wir haben halt überall unsere Informanten”, schmunzelt Heinz, "es gibt einige Leute bei der Bahn und bei den Genehmigungsbehörden, die auch keine Kernkraftwerke mögen. Außerdem beobachten einige von uns selber die Bewegungen vor den Kernkraftwerken und Verladebahnhöfen.”
Der "Tag X” - der erste Transport von verstrahltem Material ins das geplante Endlager im niedersächsischen Gorleben im April 1995 - hat auch in Heidelberg eine neue Anti-Atomkraft-Bewegung entstehen lassen. Mittlerweile zählt die Castor-Gruppe zwanzig, ihr Umfeld für spontane Aktionen vielleicht fünfzig Leute ("aber sie kommen nicht alle zu den Sitzungen”, gibt Heinz zu). Mehr als die Hälfte davon sind Studierende, zwei stehen im Beruf, der Rest sind Schüler. Nur zwei sind älter als dreißig. Diese jugendliche Zusammensetzung ist nicht repräsentativ für die Anti-AKW-Bewegung, wohl aber für den Kreis derjenigen, die sich tatsächlich vor die Züge setzen.
Politisch stehen die meisten Mitglieder der pazifistisch-anarchistischen Graswurzelbewegung nahe. Im Umfeld finden sich Leute von der Grün-Alternativen Jugend, die zu den eigentlichen Aktionen kommen.
"Früher haben wir nur auf die spektakulären Transporte nach Gorleben geachtet”, erzählt er. "Mittlerweile kümmern wir uns auch um die Transporte von Wiederaufbereitungsmaterial nach Le Hague in Frankreich und Sellafield in Großbritannien.” Natürlich hat sich die Art, wie die Aktivisten aktiv sind, auch schon gewandelt: Zu Beginn war es eine reine Aktionsgruppe, die sich kaum um Öffentlichkeit bemühte, höchstens mal ein paar Plakate klebte. Mittlerweile kümmern sie sich wie alle, die die Öffentlichkeit erreichen wollen, auch um Medienwirksamkeit. Schließlich wissen auch sie, daß das Beeinflussen der öffentlichen Meinung, mit der auch sie die Abschaltung der Atomanlagen erreichen wollen, fast nur über Presse oder Rundfunk erreicht werden kann.
"Natürlich geht es immer noch um die Aktionen als solche”, versichert Heinz, "aber es ist uns schon wichtiger geworden, daß unsere Aktionen und vor allem das, wogegen sie sich richten, in der Öffentlichkeit sichtbar werden.” Deshalb klingeln mittlerweile, wenn der Castor wieder rollt, nicht nur die Telefone der Aktivisten, sondern auch die einiger Radioreporter und Zeitungsredakteure. Und einige der Gruppenmitglieder haben sich jetzt auch theoretisch so schlau gemacht, daß sie auf Vortragsreisen zu Gleichgesinnten gehen. Außerdem sah schon der zweite Atomtransport nach Gorleben im Mai 96, "Tag X hoch 2” genannt, auch organisatorisch besser vorbereitete Atomkraftgegner in Heidelberg.
Und wie soll ohne Kernkraft der Strom in die Steckdose kommen? Die Frage langweilt schon fast. "Es gibt mittlerweile genügend Untersuchungen, die zeigen, daß wir in einem Jahr alle AKWs abschalten könnten, ohne das irgendwo das Licht ausgeht. Die Stromkonzerne selbst haben genügend Überkapazitäten aufgebaut. Aber sie wollen die Kernkraftwerke nicht abschalten, weil die ihnen den meisten Gewinn bringen”. Und auch die Erkenntnis, daß sich Atomstrom auch ökonomisch nicht rechnet, ist alt. Er lohnt sich nur für die Produzenten, die weder für die Entsorgungskosten noch für die Risiken dieser Energieart richtig bezahlen. Darum kümmert sich größtenteils der Staat. Würde man nur einen kleinen Prozentsatz dieser Kosten in den Strompreis hineinrechnen, wäre Atomstrom teurer als Solarenergie und erst recht kostspieliger als Wasser- oder Windenergie. "Ganz abgesehen davon, daß wir unseren Energieverbrauch durch einen anderen Lebensstil stark vermindern könnten”, fügt Heinz hinzu.
Und deshalb wird man die Heidelberger Castorgruppe auch am "Tag X hoch 3” in diesem Frühjahr bei Gorleben und auf der Strecke dahin sehen. "Gewaltfrei, aber Gesetze übertretend”. (hn)
Politisches Engagement, beispielsweise in der Schülermitverwaltung im Gymnasium oder im Politischen Arbeitskreis, nahm schon immer eine zentrale Stellung in Metzners Leben ein. Vielleicht waren es die Langeweile und der Kleinstadtmief im oberschwäbischen Friedrichshafen, vielleicht war es das "rabenschwarze Klima”, das dort herrschte, das ihn antrieb, politisch zu agieren. Dies mischte sich in den Folgejahren mit Eigenschaften wie Wissensdurst, Tatendrang und vielleicht auch Abenteuerlust. Metzner kam im Oktober 1967, nach einem kurzen Umweg über Amerika, nach Heidelberg, um sein Jurastudium aufzunehmen. Gerade rechtzeitig, also zur bevorstehenden Studentenrevolte, nachdem er sich zuvor noch von der amerikanischen Hippie-Bewegung inspirieren ließ. Seine politische Ader schlug nach wie vor, gerne erzählt er von seinen ersten Erlebnissen an der Universität, von der Erstsemesterbegrüßung, wo sich schon der erste (friedliche) Protest in Form von Sprechchören und Wunderkerzen bemerkbar machte. Aktiv wurde der heutige Rechtsanwalt dann erstmals in der sogenannten Heimkampagne, bei der man gegen die fatale Situation in Erziehungsanstalten aufmerksam machen wollte. "Wir konnten es einfach nicht akzeptieren, daß jedermann, ob Maler oder Metzger, in vierwöchigen Kursen Erzieher werden konnte.” Metzner zählte sich trotz allem Einsatz nie zu den extremen Linken wie den K-Gruppen. Protest ja und auch nicht zu wenig, aber mit Lust in Maßen, so das Motto des undogmatischen Linken. Hier sei nur die mehrfach durchgeführte Rote-Punkt-Aktion genannt, als sich die Studenten gegen Fahrpreiserhöhungen der öffentlichen Verkehrsmittel zur Wehr setzten. Zu diesem Zweck boten sie kostenlose Fahrdienste mit dem privaten Auto an. "Damals haben wir die Stadt beherrscht, heute beherrscht die Stadt die Studenten”, resümiert Metzner.
Treffpunkt und Schmiede der Studenten war bis Ende der 70er Jahre das Collegium Academicum in der Seminarstraße, ein von den Amerikanern 1945 eingerichtetes Studentenwohnheim, Raum für Subkultur, "ein offenes Haus, ein Ort freien Denkens”, erzählt Metzner.
Unterdessen machte Metzner sein Examen, wurde Referendar und ging für ein Jahr als Assistent an die Juristische Fakultät nach Montpellier. Dort lernte er vom "Kampf der 111 Larzac-Bauern” okzitanischer Separatisten erneut, was Widerstand bedeutet. Was er außerdem aus Frankreich mitbrachte, war das "Bewußtsein, daß Kultur und Politik unweigerlich miteinander verbunden sind und daß Politik in den Alltag integriert ist”. Mit dieser Erkenntnis im Gepäck kehrte er zurück und fragte sich, wie er dies von der Theorie in die (deutsche) Praxis umsetzen könnte. Man suchte nach einem Medium, um möglichst an eine breite Öffentlichkeit zu gelangen. Dies war die Zeitschrift "Carlo Sponti, Zeitschrift für das Leben davor”. Carlo Sponti war ein Forum für Emanzipation, Musik, Theater, Literatur, Subkultur, die Dritte Welt und Film. Dieses Projekt wurde 1978 eingestellt. Der Kreis um Metzner stand erneut vor der Frage, wie man weiterhin Kultur "unter die Leute bringen könne” und all die guten Ideen, die man im Lauf der Jahre gesammelt hatte, noch verwerten könne, eingebettet in die Konzeption der "Gegenöffentlichkeit”. Man gründete den Verlag "Das Wunderhorn”, denn Bücher haben "eine längere Haltbarkeit als Zeitungen”, so Metzner. Jörg Burkhard, "der erste linke Buchhändler Deutschlands” und Michael Buselmeier waren die ersten Autoren des Verlags. Grundsatz des Verlags, der heute aus Angelika Andruchowicz, Hans Thill und eben Manfred Metzner besteht, ist die Verbreitung von Texten vergessener Autoren oder ungewöhnlicher Literatur. Metzner nennt es "Erneuerung der Literatur nicht aus der Metropole, sondern aus der Peripherie”. Man legt Wert auf ein Verlagsprogramm "jenseits der Bestsellerlisten”, man möchte die Leser "mit neuen Inhalten konfrontieren”. Ein Programmschwerpunkt liegt deshalb in der Verbreitung frankophoner Literatur. Ein bißchen Wehmut oder gar Verbitterung ist Metzner anzumerken, als er von der Preispolitik einiger großer Verlage erzählt, die Bücher zu Tiefstpreisen verschleudern. "Die produzieren von Anfang an für die Ramschkiste.”
Aber nun zurück zu Metzners politischem Werdegang. Wir schreiben das Jahr 1984, Metzner wagte den Sprung auf größere politische Bühnen. Er wollte Heidelberg nicht den Rücken kehren, sondern hier kontinuierlich auf kommunalpolitischer Ebene etwas bewegen. Nach einiger Vorarbeit, er war z.B. Mitbegründer der Grün-Alternativen Liste, ließ er sich im Mai 1984 als OB-Kandidat neben Zundel und Müller, einem SPD-Mann, aufstellen. Schelmisch und nicht ohne Stolz blickt er auf den "spielerischen und ernsthaften Wahlkampf zugleich” zurück. Er wollte neue Ideen in die Debatte bringen, wobei Sozialpolitik, Umweltpolitik, Verkehrspolitik und Kulturpolitik im Vordergrund standen. Sowohl die Wähler als auch die Mitbewerber ("Der Zundel bekam es mit der Angst zu tun”) nahmen ihn ernst, Metzner konnte immerhin 3,9 % der Stimmen für sich verbuchen. Im Herbst 1984 ließ sich Metzner als Kandidat der GAL für das Stadtparlament aufstellen, dem er bis 1994 auch angehörte.
"Ich bin eine Person, die ständig in Bewegung ist” - so sein Motto, das bis in die Gegenwart erhalten blieb. Exemplarisch für sein aktuelles Engagement sind die Mitinitiierung der Heidelberger Literaturtage, der Initiative für ein "Prinzhorn-Museum”, oder sein Vorsitz in der Jury des Brentano-Literaturpreises zu nennen. Angesprochen auf die heutige Studentenschaft, zeigt sich der Altachtundsechziger ein wenig enttäuscht und ratlos über das mangelnde Engagement: "Die Uni ist bedrückend tot, die Studenten müssen aufmüpfiger werden. Sie sollten nicht so sehr an 'Morgen' denken. Ich verstehe nicht, warum sie nicht die Erfahrungen der 'Alten', hier in Heidelberg Gebliebenen, besser nutzen.” (jh)
Manfred Metzner und Heidelberg - eine Freundschaft, die mittlerweile schon dreißig Jahre andauert. Was jedoch nicht heißen soll, daß Metzner, heute Rechtsanwalt und Verleger, nur sonnige Tage in der Kurpfalz erlebt hätte. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Heimkampagne, die Rote-Punkt-Aktion, Collegium Academicum, Carlo Sponti, Männergruppe, 3. Welt-Laden, Gloria-Kino, Gründung des Verlages "Das Wunderhorn”, Mitbegründer der Grün-Alternativen Liste, Stadtrat, Kandidatur zum Oberbürgermeister, um nur einige Stationen in Metzners Leben und der Stadtgeschichte Heidelbergs zu nennen.
Hauptbahnhof, große Halle. Eigentlich nur mal eben auf den Fahrplan geschaut. Plötzlich eine Stimme von hinten: "Hallo bei SDR 3 Point, heute wieder live aus dem Clubhouse im Heidelberger Hauptbahnhof.” ruprecht traf Moderator Jochen Graf und sprach mit ihm über die Ambitionen, die sich mit dem Clubhouse verbinden, und die Zukunft von SDR 3.
Kurz nach 19 Uhr. Ein kühler Donnerstag im Januar. Nicht viel los im Hauptbahnhof. Neonhell erleuchtet sitzt Jochen Graf inmitten von Schaltern, Reglern und Wiedergabegeräten. Draußen ein paar irritierte Passanten. Kann man da was kaufen? Ich trete ein: "Interview für eine Studentenzeitung?” - "Klar, komm nach hinten.” Freundlichkeit gehört zum Geschäft, und es ist für den Moderatoren offensichtlich angenehm, dem sterilen Funkhaus für ein paar Stunden entkommen zu sein. Ich frage nach den Zielen, und Graf gibt bereitwillig Auskunft. Das Clubhouse ist geschaffen worden, um den Kontakt zu den Hörern zu verbessern. Mit der dort erhältlichen Clubmitgliedschaft erschließt man sich die Möglichkeit, eine Fülle von Veranstaltungen billiger zu besuchen. Nicht wenige Konzerte veranstaltet SDR3 mittlerweile in eigener Regie. In gewisser Weise stellt das Clubhouse wohl auch einen Ausgleich für das vor einigen Jahren abgschaffte Studio in Heidelberg dar.
Doch das ist nur eine Seite des Konzeptes. In den Sendungen aus Heidelberg wird die Rhein-Neckar-Region stark berücksichtigt, vor allen Dingen natürlich Mannheim und Heidelberg. Zweimal täglich geht "What's up” über den Äther, ein Informationspool für die Region. Und natürlich finden, wie schon im Stuttgarter Hauptbahnhof, renommierte Sendungen wie "Leute” und "Treff” mit prominenten Gästen statt. Doch es gibt nicht nur Unterhaltung: "Wir haben auch politische Informationen drin, zum Beispiel jetzt aktuell über die Studiengebühren, da senden wir auch Gespräche mit Studenten.” Der Hauptbahnhof sei für alle diese Zielsetzungen der ideale Ort, weil dort Tag für Tag eine große Menge Passanten vorbeiströme. Ökologisch orientiert sei man bei der Wahl des Ortes nicht vorgegangen. Werbung, Verkehrsmeldungen, Platte anlaufen lassen. Zwei Hände, tausend Schalter. Graf klinkt sich höflich aus dem Gespräch aus, zwei lockere Sprüche, dann fährt er die Platte ab. BAP, Verdamp lang her. Weiter geht's.
Durch die Diskussion um die Zusammenführung von SDR und SWF liegt es natürlich nahe, in der Schaffung solcher Einrichtungen wie der des Clubhouse einen Versuch zur Festigung des eigenen Senders zu sehen. Doch Graf negiert, der Club und seine Projekte seien schon lange vor dieser Diskussion initiiert worden. Daß es aber einen Vorteil in den Verhandlungen darstellt, mag er nicht leugnen. Der Club ist mit mehr als 330.000 Mitgliedern der größte seiner Art in Deutschland - ein schwerwiegendes Verhandlungsgewicht. "Man kommt mit den Leuten hier in Kontakt, und es tut gut zu sehen, daß sie sich für das interessieren, was mit SDR 3 geschieht.” Ob er sich ein Aus für SDR 3 vorstellen kann? "Ich gehe davon aus, daß es weiterhin ein Radio für den Wilden Süden geben wird.” Entsprechend zukunftsorientiert sind auch die weiteren Pläne. Mit dem Heidelberger und dem Stuttgarter Projekt soll das Ende noch nicht erreicht sein, Graf hofft auf Projekte in anderen Städten, wieder in Hauptbahnhöfen. Bandmaschine abfahren, Reportage von Günther Schneidewind. Ich sattele meinen Rucksack, so freundlich wie beim Eintreten geht's auch in die andere Richtung zu. Tür auf, schwarz, kalt. Und während ich Ewigkeiten auf den Bus warte, denke ich mir: Feine Sache, dieses Clubhouse; da schaust Du auch privat mal wieder rein. (papa)
Die Darstellung geschichtlicher Abläufe, festgemacht an einem konkreten Ort und einzelnen Personen, ist besonders eindrücklich. Heinrich Schipperges, bis 1986 Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin der Universität Heidelberg, gelingt dies mit der vorliegenden Chronik, die eigentlich als Gesamtdokumentation für die Ärzteschaft Heidelberg entstand.
Verständlicherweise kann Schipperges den so programmatischen Untertitel nicht umsetzen. Kurz führt er mit dem Fund des Maurer Unterkiefers und der Frühgeschichte der Ärzteschaft im Mittelalter ein, während sich der Hauptteil mit der Entwicklung der Medizin und der Universität in Heidelberg vom Mittelalter bis heute beschäftigt. Der Umbruch der Medizin im 19. Jahrhundert wird dabei besonders hervorgehoben. Dabei ordnet Schipperges immer wieder die Entwicklungen in Heidelberg dem globalen Geschehen zu. Abschließend stellt er noch die augenblickliche Situation in Heidelberg dar, indem Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen und andere Institutionen vorgestellt werden.
Attraktiv und anschaulich wird die Chronik, da Schipperges hauptsächlich Zeitzeugen reden läßt und selbst nur die Zusammenhänge deutlich macht. Ihnen überläßt er auch die Beurteilung. "Die ältere Geschichte freilich”, so Becker 1876,” habe weniger Erfreuliches zu bieten. Perioden des Glanzes habe es in Heidelberg vor dem 19. Jahrhundert nie gegeben.” Somit erfolgt die Darstellung über Biographien und Zitate von Personen, die für ihre Zeit wichtig, typisch oder originell sind. Kritisch anzumerken ist, daß dabei manche Auszüge auf Latein ohne Übersetzung wiedergegeben werden.
Interessant für den Leser ist die Entwicklung des verherrlichenden hippokratischen Arztbildes vom "Baumeister der Gesundheit”, "ein Licht im Hause, das Dunkel erleuchtet und Freude verbreitet” zur selbstkritischen Betrachtung des Chirurgen Ambroise Paré im 16. Jahrhundert: "Oft kommen die Patienten eher, wie mir scheint, durch göttliche Gnade davon, als durch menschliche Hilfe.” Aber auch zeitlose Prinzipien werden deutlich. "Ein anständiger Chirurg soll den Kranken nicht wie die Sau den Bettelsack anfahren und mit ihm tyrannisch nach seiner Wuth umspringen; mit einem zarten Mann nicht wie mit einem Drescher, noch mit einem Menschen gleich einem Hunde umgehen”, so "Des getreuen Eckardt's verwegener Chirurgus” 1698.
Immer wieder unterbricht Schipperges für grotesk anmutende Züge der Medizingeschichte. Hier die Schilderung eines "Anatomischen Theaters” im 16. Jahrhundert: "Nach einem musikalischen Intermezzo rollte man einen großen Tisch in den Salon. Der Operateur erläutert dann mit leiser Stimme die Sektion; von Zeit zu Zeit wird die Vorlesung durch Musik unterbrochen; Erfrischungen werden herumgereicht, und die Damen genießen Eis oder kleine Kuchen.” Nachdenklich zur Zeit der Gesundheitsreform und Kostendämpfung die Diskussion um Reduzierung der "Irren- und Siechenanstalten” 1829 aus Budget-Gründen, "damit die Kanditaten des Jammers eher und besser - sei es auch durch die Pforten des Hungertodes - ins Himmelreich ... gelangen. Wie viele Kosten könnten gespart werden...” Aber auch in unserem Jahrhundert läßt sich Kurioses finden, so das "Sozialistische Patientenkollektiv Heidelberg” in den 70er Jahren. Die reichliche Ausstattung mit mittelalterlichen Buchdarstellungen, Ansichten historischer Gebäude und Bilder der Portraitierten belebt das Lesen zusätzlich.
So ist dieses Buch nicht nur Medizinern zu empfehlen, die sich mit ihrer Tradition auseinandersetzen sollten, sondern jenen Heidelberg- und Geschichtsinteressierten, die sich auf eine etwas andere Sichtweise einlassen wollen. (jm)
Heinrich Schipperges: Ärzte in Heidelberg.
Eine Chronik vom "Homo Heidelbergesis” bis zur "Medizin
in Bewegung”
Edition Braus, Heidelberg 1995.
248 Seiten, DM 58,-
Benannt nach einer tragischen griechischen Sagengestalt, ist Elektra eine der großen Schöpfungen von Frank Miller. In den frühen Achtzigern, als er noch den Daredevil für Marvel schrieb, schuf Miller, dem wir nebenbei noch "Return of the Dark Knight” oder zahlreiche "Martha Washington” und "Sin City” Titel verdanken, einen Charakter, dessen Stories zu den Meilensteinen der Comicgeschichte zählen.
Eingeführt wurde Elektra als junge Tochter des griechischen Botschafters Natchios und Geliebte von Matt Murdock, alias Daredevil, aber schnell verwandelte sich die zarte Griechin nach der Ermordung ihres Vaters in eine zwielichtige Gestalt: Ausgebildet als Ninja, um ohne Gefühle zu töten, verdient sie sich ihren Unterhalt als Kopfgeldjägerin. Kein Wunder, daß sie wieder auf Daredevil traf, diesmal jedoch auf entgegengesetzten Seiten. Ihr Gastauftritt in der Daredevil-Serie war schnell vorbei, als ein verrückter Killer namens Bulls-eye sie tötet. Daredevil fand nicht einmal ihre Leiche, Elektra war verschwunden, aber nicht aus seiner und Millers Erinnerung. Darum war es auch nicht verwunderlich, daß Elektra ihre eigenen Miniserien bekam. Dabei entstanden zwei Geschichten, die noch heute Maßstäbe setzen.
Mit Bill Sienkiewicz schuf Miller die in den Jahren '86/87 erstmals erschienene preisgekrönte "Elektra: Assassin”-Story, die durch die künstlerische Gestaltung Sienkiewiczs zu den Klassikern der Comicgeschichte zählt. Kein Wunder, daß "modern graphics” die Hefte als gebundenes Album Ende letzten Jahres endlich auf den deutschen Markt brachte.
Drei Jahre später war es dann wieder Miller, der mit "Elektra lives again” von sich reden machte, als er in dem von Lynn Varley kolorierten Band Elektra für Daredevil noch einmal auferstehen und wiederum in Murdocks Armen sterben ließ. Die Figur der Elektra war aber keineswegs damit gestorben: Ohne Elektra-Erfinder Miller erschien 1995 nämlich die vierbändige Miniserie "Elektra: Root of Evil” von Chichester und Scott McDaniels, denen auch die Ehre zuteil wurde, das Elektra- Special "Assassins” für den Comiccrossover des Jahres 1996 bei Amalgam (wie der Zusammenschluß der beiden Comicverlage Marvel und DC) zu zeichnen. Und dabei sollte es nicht bleiben: Erste zaghafte Gastauftritte bei Wolverine ließen schon darauf hindeuten, daß Marvel Epic Comics, dem es zur Zeit sowieso finanziell nicht besonders gut geht, den beliebten Star wieder ins Programm nehmen wollte. Und so startete vor drei Monaten Elektras erste "ongoing” Serie. Nur: Wer Millers brutale kaltherzige Killerin erwartet, wird mit einer gutherzigen Wohltäterin überrascht, die man gar nicht mehr wiedererkennt. Ihr glattes schulterlanges Haar verwandelte sich wundersamerweise in hüftlange Locken, ihr Dress wurde noch knapper und bekam einen metallischen Glanz, aber der gravierendste Wandel ist die neue Persönlichkeit. Sie jobbt als Tänzerin, um ihr eigenes Dojo zu finanzieren, in dem sie Straßenjungen aufnimmt. Kurz gesagt: Aus dem Dämon des Todes wurde ein Engel - ganz und gar untypisch für Miller, der für seine äußerst brutalen Geschichten bekannt ist. Es bleibt daher abzuwarten, ob die neue "Elektra”-Serie bei den Lesern ein Erfolg sein wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist jedoch gering, denn "good girls”-Comics gibt es wie Sand am Meer.
(jr)
Incognito: Beneath the surface
Incognito ist neben Jamiroquai im Funk-Bereich eine
der wenigen Bands, die gekonnt diesen Stil aufgriffen und neu
interpretiert hat. Nach Superseller "Always there” kamen
noch einige ganz passable Singles, die LPs von Incognito
konnten jedoch nicht überzeugen. Zu unausgewogen, teilweise
monoton.
Das änderte sich 1995 mit "100 and rising”, einem
durch und durch soliden Album, das durch die fetzigen Bläsersätze,
den groovigen Baß und natürlich durch den in diesem
Bereich seltenen weiblichen Gesangspart überzeugte. Mit dem
aktuellen Album präsentiert sich Incognito ganz erwachsen,
ausgefeilte Arrangements, abwechslungsreich und gekonnt interpretiert.
Die Qualität bestimmt aber ein weiterer Faktor: Das musikalische
Multitalent, das hinter diesem Projekt steht, bleibt nicht weiter
inkognito. Jean-Paul Maunick singt erstmals bei mehr als der Hälfte
der Songs, eine der intensivsten schwarzen Stimmen, die derzeit
zu hören sind. "Beneath the surface” ist Titel
und Programm zugleich. Unter der Oberfläche einer "Pop-Band”
stecken hervorragende Musiker. Brilliant ist überdies die
Mischung von Funk- und Latino-Rhythmen und die durchgehende Einbindungn
von filigraner Percussion. (papa)
Pat Metheny Group: Quartet
Metheny ist Legende. Immer angesagt und doch niemals modisch. Das neueste Werk "Quartet” ist das Produkt einer eingespielten Mannschaft, mit der Metheny seit mehr als 15 Jahren immer wieder zusammenkommt. Die Prämisse für dieses Projekt war die Verwendung von möglichst wenig elektronisch unterstützten Instrumenten, was vor allen Dingen Metheny selbst nicht immer ganz ernst nimmt. Darüberhinaus nimmt die Improvisationskunst einen weiten Raum ein. Während früher Metheny nicht zuletzt durch seine außergewöhnlichen Kompositionen überzeugte, stehen hier seine Fähigkeiten als Gitarrist und natürlich seine Mitspieler stärker im Vordergrund. Das macht die Songs nicht zum Freejazz, allen liegen mehr oder minder ausgearbeitete Konzepte von Metheny oder seines ausgezeichneten Pianisten Lyle Mays zu grunde. Das Album ist vielseitig, insgesamt eher ruhig und differenziert im Klangspektrum. Einige Songs sind der Rhythmik und der Klänge wegen gewöhnungsbedürftig, manches wirkt gezwungen avantgardistisch. Die meisten der insgesamt 15 Songs aber bestechen durch die spielerische Leichtigkeit des Quartetts und deren Spielwitz. Ein ungewöhnliches Album, das den "Group-Charakter” stärker unterstreicht denn je. (papa)
Astor Piazzolla: Tango: The Late Masterpieces
Kein Musiker ist eine so tiefe und langandauernde Gefährtenschaftmit
dem Tango eingegangen wie Astor Piazzolla, der König des
Tango Nuevo. Er machte aus Unterhaltungsmusik Kunst und erhob
den Blues der armen Argentinier zu einer Kunstform.
Mit seinem Instrument, dem Bandoneon, war er so verwachsen, daß
es schwerfällt, sich vorzustellen, daß es noch andere
Bandoneon-Spieler gibt. Er spielte das Bandoneon im Stehen, statt
wie eigentlich üblich im Sitzen, weil er "nicht wie
eine strickende Oma aussehen” wollte, wie er einmal sagte.
1992 starb der Meister 71jährig in Buenos Aires.
Jetzt ist sein Spätwerk erschienen, Aufnahmen, die 1986 in
New York entstanden. Piazzolla zeigt hier die verschiedensten
Aspekte seiner Kunst. Er war mit größtem Ehrgeiz am
Werke und hielt das Ergebnis für "die beste Platte,
die ich jeh gemacht habe”.
Auch wenn manche Klangeffekte bisweilen etwas aufgesetzt wirken,
so fällt es doch schwer, sich der Melancholie zu entziehen.
Expressive, fast expressionistische Stücke stehen neben Gefühlswalzen,
die einem den Atem stocken lassen, einem vor Sehnsucht die Kehle
zuschnüren. Für Einsteiger harte Kost, für Piazzolla-Fans
ein Muß. (fw)
Johann David Heinichen: Lamentations
"Immer nur Bach? Damit muß jetzt Schluß sein!”, mag sich Reinhard Goebel, der Leiter der Musica Antiqua Köln, gedacht haben, als er 1993 concerti grossi des bis dahin doch recht unbekannten Barrockkomponisten Johann David Heinichen veröffentlichte. Aufgrund der begeisterten Reaktionen wurde nun Passionsmusik Heinichens eingespielt und veröffentlicht.
Wer aber ist dieser Heinichen? Er war der Kapellmeister August des Starken, ein recht berühmter Zeitgenosse Bachs. Man nannte ihn den "deutschen Rameau”, weil er wie sein französischer Kollege Jean-Phillipe Rameau nicht nur musicus practicus, sondern auch musicus theoreticus war. Seine 1000 Seiten starke Generalbaßschule ist für uns heute zwar unterträglich schwer und langweilig zu lesen, aber sie war ein Standardwerk seiner Zeit. Heute wird er kaum noch gespielt.
Für all jene, die nicht immer nur Bach hören wollen, ist die Wiederentdeckung Heinichens eine Wohltat. Die Beschäftigung mit Heinichen zeigt nicht nur, wie beschränkt unser musikalisches Geschichtsbild bisweilen ist, sondern sie ist auch ein ästhetisches Vergnügen. Die Interpretation der Musica Antiqua Köln ist dabei über jede Kritik erhaben. (fw)
Mit großer Spannung erwartete das Publikum am 27.1. das Eröffnungskonzert der Konzertreihe "World of Klezmer” im Karslstorbahnhof. Schon für das erste Stück bedankte sich das Publikum mit begeistertem Applaus.
Und das, obwohl das "Ensemble Budowitz” rauhe, harte und urwüchsige Musik bot und dabei auf Klangschönheit nicht immer Rücksicht nahm. Wenn auch der Versuch, aus dem Konzert eine chassidische Hochzeit zu machen, scheiterte, genossen doch alle Spielwitz und Spielfreude der Musiker. "Wir alle haben die Folter einer klassischen Ausbildung überlebt und können aus unerklärlichen Gründen immer noch musizieren”, erklären sie ihre unverkünstelte Spielweise. Die Klezmorim des Ensembles wollen Klezmer so authentisch wie möglich spielen, also auf Trompeten, Saxophone und Schlagzeug verzichten und stattdessen auf die klassischen Klezmer-Instrumente wie Geige, Tsimbl (ein Hackbrett), Klarinette und Cello zurückgreifen.
Klezmer, die traditionelle Volksmusik der Juden Osteuropas, feiert eine Renaissance in Europa. Nachdem in den 70ern Klezmer-Musik in den USA wiederentdeckt wurde, interessiert man sich in den letzten Jahren auch in Europa immer mehr für diese gefühlvolle Musik. Giora Feidman füllt Konzertsäle, und in dem Film "Jenseits der Stille” wollen junge Mädchen Klezmer lernen.
Ein Klezmer-Ereignis der letzten Monate hatte der Bewegung weiteren Schwung gegeben: der Film über die "Epstein Brothers” mit dem Titel "A Tickle in the Heart”. Hier wurden die Epstein-Brothers, drei amerikanische Klezmorim, auf ihren Konzerten begleitet und interviewt. Die drei Brüder, mittlerweile im Rentenalter und vom anstrengenden New York ins rentnergerechte Florida gezogen, sind mittlerweile zu gefeierten Ikonen der Klezmer-Szene avanciert. In den 60er Jahren blühte das "wedding bussiness” in New York, und die Epstein-Brothers spielten auf einer chassidischen Hochzeit nach der anderen. Mittlerweile hat der kleine, aber feine Musikverlag WERGO zwei CDs der Brothers herausgebracht, die einen wunderbaren Einstieg in die Klezmermusik bieten.
Am 25.2.1997 wird die Konzertreihe vom Ensemble "AHAVA RABA” fortgesetzt. Ihnen geht es nicht darum, möglichst authentischen Klezmer zu spielen. Vielmehr sind sie für Grenzgänge zwischen den Musikkulturen bekannt. Für ihr neues Programm ließen sie sich von turkmenischer, bulgarischer, armenischer und chinesischer Volksmusik inspirieren. Man wird sich wohl frühzeitig um Karten bemühen müssen. (fw)
"World of Klezmer” im Karlstorbahnhof:
26.2.97 AHAVA RABA
18.3.97 Helmut Eisel und Jem
8.5.97 Sabbath Hela Veckan
(in Klammern die Anzahl der ruprechte)
| ruprechts Notenskala: | |
| - | nicht empfehlenswert |
| * | mäßig |
| ** | ordentlich |
| *** | empfehlenswert |
| **** | begeisternd |
Rossini (4)
Deutsche Komödie - endlich mal ganz anders. Und das nicht nur, weil Katja Riemann nicht dabei ist. Helmut Dietl ("Schtonk”) gelingt es in seinem neuen Film "Rossini”, Wortwitz und Tiefe, Glamour und Schwachsinn auf geistreiche Weise zusammenzubringen.
Die Münchner IntellektuellenSchickeria trifft sich Abend für Abend beim Edel-Italiener "Rossini”, wo sie vom Wirt (Mario Adorf) bestens versorgt wird. Regisseur Uhu Zigeuner (Götz George) will mit Produzentenfreund Oskar (Heiner Lauterbach) den Bestseller "Loreley” "leidenschaftlich, faustisch, deutsch” verfilmen. Problem eins: der Autor (einfach rührend: Joachim Krol) - obwohl Freund und Teil der Clique - weigert sich. Problem zwei: Die Banker drohen, den Produzenten ohne Filmrechte zu "killen”. Problem drei: Keine der blonden Schauspiel-Schönheiten ist unschuldig genug, die "Loreley” zu verkörpern. Bis Schneewittchen (engelsgleich und doch nur plump: Veronika Ferres) auftaucht und den Männern den Atem raubt. Nebenbei gibt es menschliche Opfer. Valerie (Gudrun Landgrebe) kann sich zwischen ihren beiden Liebhabern, männlich-markante Sicherheit und feurige Dichterleidenschaft, nicht entscheiden. Menschen, die scheinbar alles haben und doch nicht genug kriegen können, verlieren sich in ihren Möglichkeiten und bleiben einsam im Kreis ihrer Freunde und Liebhaber. Und obwohl "das Leben wichtiger als jeder Film” ist, siegt am Ende der schöne Schein. Tragisch und wahr ist das schon, aber - wie Dietl beweist - vor allem saukomisch.(jb)
Paloonkaville (3)
Gut geplant ist halb gewonnen. Doch eben nur halb. Das müssen
Jerry, Sid und Russ schnell bei ihren Beutezügen erkennen.
Mühsam schlagen sie ein Loch in die Ziegelwand des Juweliergeschäftes.
Gleich werden sie die Klunker in ihren Händen spüren.
Aber diese sind weich, süß, schmecken gut, heißen
Donuts und befinden sich in der benachbarten Bäckerei. Somit
haben sie nicht nur den Schaden, sondern werden auch noch zum
Gespött der Polizei.
Vom großen Coup träumend schmieden sie die verrücktesten
Pläne, die dem Zuschauer die Hände vor die Stirn schlagen
lassen, und treten dabei tapfer von einem Fettnäpfchen ins
andere. Sie sind halt einfach zu lieb und zu doof. Da fahren sie
hinter einem Geldtransporter her, dessen Fahrer einen Infarkt
bekommt, doch bringen sie den Lebensgefährdeten ins Krankenhaus
und den Wagen ins Geschäft zurück.
"Palookaville” ist eine äußerst unterhaltsame
Gaunerkomödie, die völlig auf Spezialeffekte und blutrünstige
Szenen verzichtet und dadurch an Charme gewinnt. (te)
Sleepers (2)
Sleepers - das sind Menschen, die in Jugendhaft waren. John, Michael, Thomy und Shakes verbringen ihre Jugend Mitte der 60er Jahre in der Vorstadt Hell's Kitchen. Dort regiert die Korruption, aber die Sozialstrukturen sind für die Kinder lebensfreundlich. An einem heißen Sommernachmittag wird dann unkontrolliert und ungewollt aus einem Jungenstreich ein Verbrechen: Die vier sind verantwortlich für einen Unfall, der für den Betroffenen beinahe tödlich endet. Ein Gericht verurteilt die Jungs zu einer mindestens einjährigen Haftstrafe. In der beschaulich wirkenden Haftanstalt verändert sich ihr Leben: Sie werden zu Objekten sexueller und psychischer Mißhandlung der Wächter. Der auf sie ausgeübte Druck ist stark genug, daß sie niemandem davon berichten. 14 Jahre später sind John und Thomy Berufsmörder, Shakes Zeitungsreporter und Michael Staatsanwalt, als John und Thomy auf ihren schlimmsten Peiniger treffen. Sie ermorden ihn vor Zeugen. Michael initiiert nun einen raffinierten Prozeß, bei dem er als Staatsanwalt auftritt und zugleich die Verteidigung übernimmt, indem er über Shakes einen alkoholabhängigen Anwalt als Strohmann einsetzt.
Ein ungewöhnlicher Film, in dem das Wort Selbstjustiz eine für amerikanische Verhältnisse ungewohnte Färbung erhält. Zwei Mankos hat der Film aber in jedem Fall: Zum einen hat "Rain Man”-Regisseur Levinson die Geduld des Sitzfleisches seiner Zuschauer überreizt. Zum anderen hat das ungeheure Staraufgebot der Plastizität der Figuren geschadet, auch wenn vor allem DeNiro und Hoffman sehr überzeugen. (papa)
Praxis Dr. Hasenbein (3)
chneider, der auch für Buch, Regie und Musik verantwortlich zeichnet, mimt Arzt Dr. Angelika Hasenbein, der auf seinem knatternden Moped durch die Stadt fährt, um den Kranken zu helfen, Wundertüten zu kaufen und mit Frau Holzkiste über den Unsinn von Tageszeitungen zu philosophieren ("Wenn da sowieso jeden Tag was anderes drinsteht, dann ist das ja auch nichts!”). So entstehen die berüchtigten Schneider-Dialoge, die je nach Zuschauer zu Lach- oder Magenkrämpfen führen. Aber es gibt sogar eine Handlung: Während Hasenbeins Sohn Peterchen ruhig mit seinem Ball spielt, geschieht Fürchterliches - der Hamster der Waisenkinder wird krank, und Dr. Hasenbein tut sein Bestes, um den Waisenkindern zu helfen. Da "Heilen sowieso nichts bringt”, wirft er den Hamster mitsamt Karton auf den Boden und trampelt ihn platt - kann man die Krankheit nicht beseitigen, beseitige man den Kranken, so einfach ist das. (hpc)
Noch zweimal in diesem Semester bietet sich im Kino im Feld und bei movie in der Neuen Uni die Gelegenheit für wenig Geld viel Film zu bekommen. ruprecht kennt die Termine:
movie:
5.2. Echte Kerle
12.2. Pocahontas
Kino im Feld:
6.2. Mission
13.2. Wallace and Gromit
Zum Artikel "Vive le prof!” (Autor ah; ruprecht-Ausgabe 45)
Als einer, der zur Zeit ein Auslandssemester in Montpellier genießt,
muß ich den Artikel "Vive le Prof” kritisch kommentieren:
Zwar gilt in Frankreich wohl für alle Fächer, daß
der Aufbau des Studiums verschulter ist als bei uns, als Austauschstudent
muß einen das aber nicht allzusehr kümmern. Der Vorlesungsstil
ist dagegen nicht überall so, wie im Artikel von Andreas
Hüske beschrieben: In Mathematik z.B. wird der Prof keineswegs
als Halbgott behandelt, die Atmosphäre der Vorlesung ähnelt
der in HD, und an der kleinen theologischen Fakultät in Montpellier
herrscht ein fast familiäres Verhältnis. Kein Grund
also, Montpellier als Ort für ein Auslandssemester zu meiden.
Martin Bauer
zu "Ein Phantom aus dem Ozean der Geschichte” (gan) und "'Revolutionäre Pflicht'” (fw; ruprecht 45)
(...) (A)uf Seite 9 [wird] Lothar-Günther Buchheim aus Anlaß seines Nachdrucks "Jäger im Weltmeer” von 1943 interviewt, außerdem dieses Buch besprochen; Tenor und letzter Satz des Ganzen: "Der Nazi Buchheim existiert nicht.” Außerdem (...) wird in der gleichen Ausgabe, auf Seite 11, Sternburgs Biographie über Carl von Ossietzky vorgestellt. (...) In meinen Augen habt Ihr eine Grenze überschritten. (...) (I)ch nehme das jedenfalls nicht einfach so hin!
Die Reinwaschung des Nazi Buchheim
(...) [Buchheims] Buch bietet eine Fülle von Belegen für die Sprache faschistischer militarisierter Männlichkeit. (...) Von Seite 12 bis Seite 15 beschreibt Buchheim begeistert (...) "ans Übermenschliche grenzende Zeugnisse soldatischer Pflichterfüllung” (S.12). Das können nur Deutsche. Sie sind halt doch Übermenschen. Wie hieß das im ruprecht? "Herrenrasse ausgelassen” (gan)? (...) Faschistische Männer wie (...) Buchheim waren - wie es Goldhagen erläutert hat - nicht einfach Nazis, (...) sie waren (...) 150%ige Nazis! An der Ostfront eingesetzt, hätten solche Leute jüdische Menschen so (...) übereifrig gequält und hingeschlachtet, wie es Goldhagen von den dortigen Nazis beschreibt. (...)
(D)ie einzige Stelle im (...) ganzen sonstigen Buch (...), an der von den Opfern der Angriffe gesprochen wird, lautet: "Wie Affen sind die Leute in die Boote gestürzt.” (S.15) Sie sind selbst als Opfer keine Menschen, sondern verhalten sich "wie Affen”. Wie war das im ruprecht? "Von deutscher Herrenrasse ist hier nichts zu sehen.” (gan) (...)
Die zweite Ermordung Ossietzkys
Also: Buchheim ist ein Nazi gewesen, durch und durch - und er ist es noch heute. Buchheims "Jäger im Weltmeer” ist das Werk eines faschistischen, militarisierten Mannes. Buchheim ist auch ein Mörder! Mit seiner Ideologie der übereifrigen Pflichterfüllung ist das Buch im Jahre 1943 als schlimmste Durchhaltepropaganda (...) anzusehen. (...)
Ist Euch eigentlich allen klar, was Ihr da gemacht habt? Ihr sprecht Buchheim nicht nur bei seinem Nazi-Werk von 1943 von Nazi-Ideologie frei, nein, ihr besucht ihn aus Anlaß dieses Buches auch noch in Bayern, in Feldafing, und befragt ihn auch noch untertänigst nach sonstigen Rechtfertigungen. Und was passiert zwei Seiten später? Da wird dann eine neue Biographie von Carl von Ossietzky besprochen, nicht ohne unerwähnt zu lassen, daß Biograph von Sternburg meint (ein Adliger, der seinen Stand verteidigt, aha!), Ossietzky sei "in seinem Herzen ein Patriot” gewesen. Schöner Patriot. Er hat sich für den heute so aktuellen Spruch (...) "Soldaten sind Mörder!” schon in Weimar vor Gericht verantworten müssen und wurde von den Nazis u.a. dafür ermordet. (...)
Als Graswurzelrevolutionär fühle ich mich unter anderem der radikalpazifistischen Tradition Carl von Ossietzkys verbunden. (...) (D)eshalb verbitte ich mir Artikel über Ossietzky und Buchheim (...) in der gleichen Ausgabe! Ermordeter und Anhänger der Mördersippe schließen sich aus! Der Journalist Ralph Giordano hat einmal über die Verdrängung der Aufarbeitung der NS-Zeit und die Reinwaschungstendenz der Nazis ein Buch geschrieben mit dem Titel: "Die zweite Schuld”. Analog empfinde ich Eure Veröffentlichtung der Ossietzky-Rezension als so etwas wie "die zweite Ermordung Ossietzkys”! (...)
Warum tischt Ihr auch noch diesen Rechtfertigungsmythos von der Suhrkamp-Geschichte auf, genauso wie Buchheim sie sehen will. Was erfahren wir aus dem Buch über Suhrkamp? Er hat zunächst einmal den jüdischen S. Fischer-Verlag unter seinem, Suhrkamps, Namen übernommen, als "dessen jüdische Besitzer zur Emigration gezwungen waren” (Nachwort von A. Rost, VII). Suhrkamp war also Profiteur der Arisierung der Wirtschaft. (...) Suhrkamp war ein halbes Jahr im KZ, ja, aber das weist ihn keineswegs als Widerstandskämpfer aus. Es gehört eben zu den nazistischen Selbstverständlichkeiten, daß Nazis auch Nazis ermordeten oder sie fälschlicherweise des Verrats bezichtigten oder sie in Ungnade fallen ließen. (...) Buchheim hatte (...) nachweislich gute Kontakte zum zweitwichtigsten Nazi [Dönitz] überhaupt. Aber was meint "gan”? "Der Nazi Buchheim existiert aber nicht.” (...) (W)er den Buchheim so bespricht wie geschehen und die ganze hier belegte Nazi-Ideologie nicht wahrnimmt, der ist, ja was ist er? Entweder blind oder selbst ein Nazi! (...)
Ich fordere Euch also auf, (...) Eure Maßstäbe journalistischer Ethik offenzulegen. (...) Zumindest würde ich eine Entschuldigung bei den LeserInnen erwarten (...).
Ich jedenfalls halte die Veröffentlichung des Buchheim-Interviews und der Besprechung selbst schon für einen rechtsextremen Akt, für den m.E. die ganze Redaktion verantwortlich ist. (...) Es mag etwas abgelutscht klingen und ich vermeide solche Sätze im allgemeinen lieber, aber bei so was muß ich doch sagen: In meiner AStA-Zeit wäre das unmöglich gewesen.
Reinhard (Red. Süd "Graswurzelrevolution”)
Antwort von ruprecht-Redakteur Gabriel A. Neumann (gan) auf den nebenstehenden Leserbrief
Die Folgerungen aus den als Nachweis angeführten Textstellen sind so nicht haltbar. Will man, wie es in dem Leserbrief geschehen ist, die Verwendung einer sozial- und ideologietypischen Sprache nachweisen, darf man sich zu diesem Zweck nicht nur auf isolierte Zitate berufen, sondern muß eine Reihe von Faktoren berücksichtigen: Zitatzusammenhang, Entstehungsgeschichte, Textform sind nur einige von vielen. Natürlich sind Textstellen wie die angeführten, würden sie heute und einzeln niedergeschrieben, nicht zu akzeptieren. Aber:
- Was das "Affen”-Zitat angeht, ist es nicht beispielhaft für einen etwaigen Tenor des Buches - Äußerungen, die auf eine rassistische Haltung des 24jährigen Buchheims hinweisen würden, gibt es in "Jäger im Weltmeer” ("JiW”) nicht.
- Im Kontext gelesen, beziehen sich "ans Übermenschliche grenzende Zeugnisse soldatischer Pflichterfüllung” nicht auf die Naziverwirrung vom deutschen Herrenmenschen, sondern auf Soldatentum.
Ich verstehe, daß es Reinhard bei einem Satz wie dem zitierten die graswurzelrevolutionären Nackenhaare aufstellt. Aber Soldatentum ist nicht gleich Nationalsozialismus, und mit dem Rassenwahn dieser menschenverachtenden Ideologie hat die soldatische Denkweise in "JiW” nichts zu tun. Ich will übrigens nicht die Verbrechen der Wehrmacht und ihre Beteiligung am Holocaust bezweifeln. Aber aufgrund dieser viel zu späten Erkenntnisse, nicht zuletzt der Goldhagen-Debatte, jeden ehemaligen Wehrmachtsangehörigen zum potentiellen Judenschlächter abzustempeln, wie es im Brief mit Buchheim getan wird, ist die Tat eines Politpolichinelle. Es bringt keinen weiter, am wenigsten die Aufarbeitungsdebatte.
Es ist für mich nachvollziehbar, daß ein Radikalpazifist seine Einwände gegen Buchheim hat, der sich ausdrücklich nicht mit den Idealen der "Ostermaschierer” identifiziert. Aber ihn deshalb mit Militaristen und Nationalsozialisten über einen Kamm zu scheren, findet weder im Text von "JiW” noch in Buchheims Nachkriegspublikationen seine Begründung. Ist einem heute geschriebenem Text ein Jünger-Zitat vorangestellt, sind gewisse Schlüsse auf eine rechtslastige Haltung des Verfassers möglich. Im Jahre 1943 war es zumindest zweideutig, was mit dem Wort von der "Freiwilligkeit” in Buchheims Jünger-Stelle gemeint war. Oder man zähle die Hakenkreuze im Bildteil von "JiW” - das einzige ist spiegelverkehrt. Diese Dinge sind natürlich keine klaren Aussagen gegen das Nazi-System, die wird man in "JiW” vergeblich suchen. Aber sie zu erwarten, wäre naiv, denn schließlich gab es die Zensur. Daß im "Boot” und in der "Festung” eine antifaschistische und antimilitaristische Haltung ausgedrückt ist, ist Fakt.
Die Behauptung, Suhrkamp habe sich an der Arisierung bereichert und sei selbst ein Nazi gewesen, ist mehr als nur Ausdruck unglaublicher Ignoranz. Suhrkamp hat nicht nur durch die Übernahme des S. Fischer-Verlags nachweislich viel zu dessen Überleben im Dritten Reich beigetragen und kam im KZ fast ums Leben, sondern prägte auch das kulturelle Leben der westdeutschen Demokratie. Wer einen Menschen wie Suhrkamp zum Nazi macht, nur um nicht von der eigenen Argumentation abweichen zu müssen, zeigt, daß die eigene Auffassung von politischer Korrektheit der Objektivität vorgeht. So wird auch die Forderung an den ruprecht verständlich, einen positiven Artikel über Buchheim nicht gleichzeitig mit einer Ossietzky-Rezension zu drucken: Für Nonkonformes bleibt im schwarz-weißen PC-Weltbild kein Platz.
ruprecht-Redakteur Felix Wiesler (fw) zur "zweiten Ermordung Ossietzkys”
1. Zum "Fall Buchheim” werde ich mich nicht äußern, da ich weder seine Lebensgeschichte im Detail kenne noch irgendeinen seiner Texte gelesen habe.
2. Genausowenig wie ich Carl von Ossietzky boykottiere, weil er nicht auf das "von” in seinem Namen verzichtete, boykottiere ich den Ossietzky-Biographen Wilhelm von Sternburg.
3. Ich habe geschrieben, von Sternburg habe wohl recht, wenn er schreibe, Ossietzky sei "in seinem Herzen ein Patriot” gewesen. Wenn auch derartige Thesen schwer beweisbar sind, so gibt es in diesem Fall zahlreiche Hinweise dafür, daß von Sternburg mit seiner These recht hat. So hätte sich beispielsweise Ossietzky vom Vorwurf des Landesverrates wohl kaum so getroffen gefühlt, wenn er sich mit Deutschland in keiner Weise verbunden gefühlt hätte.
Busfahrer! Zieh' die Jacke aus! - te
papa! Machen wir jetzt das Foto?! Ich will mich endlich
mal wieder waschen! - hn
Felix! Paß auf, daß Dich der Große nicht
wieder zu doll knuddelt! - Die kleine Schwester
Walzerkönigin! Ich hab' Dir Deinen Kopfkissenbezug
geklaut! - gan
Jürgen! Ich besuch Dich gern! - G.
Nicole! Ceterum censeo, neue Bude jetzt! - gan
Christoph? Wo steckst Du? - bpe
ruprecht, die Heidelberger Student(inn)en Zeitung, erscheint drei Mal im Semester, jeweils Anfang Mai, Juni, und Juli, bzw. November, Dezember und Februar. Die Redaktion versteht ruprecht als unabhängiges Organ, das keiner Gruppierung oder Weltanschauung verpflichtet ist. MitarbeiterInnen und RedakteurInnen sind willkommen; die Redaktion trifft sich während des Semesters jeden Montag um 20 Uhr im Haus der Fachschaften in der Lauerstr. 1, 3. Stock. Für namentlich gekennzeichnete Artikel übernimmt der/die AutorIn die Verantwortung.
V.i.S.d.P.: Gundula Zilm, Schiffgasse 9, 69117 Heidelberg
Redaktionsadresse: ruprecht, Lauerstr.1, 69117 Heidelberg, Tel./Fax 06221/542458, E-Mail: ruprecht@urz.uni-heidelberg.de
Organisations- und Layoutleitung: hn,bpe, gz
Graphiken: jr, bw, hn
Druck: Caro-Druck, Frankfurt a.M.
Auflage: 12.000
Die Redaktion: Julia Bonstein (jb), Helge Cramer (hpc; Anzeigenakquisition), Bertram Eisenhauer (bpe), Thilo Elsässer (te), Jörg Heyd (jh), Markus Jakovac (mj), Lena Kempmann (lk; Heidelberg), Jochen Maul (jm), Gabriel Neumann (gan), Harald Nikolaus (hn; Hochschule), Patrick Palmer (papa; Fotos), Jannis Radeleff (jr; Anzeigenlayout), Felix Wiesler (fw; Kultur), Bernd Wilhelm (bw), Gundula Zilm (gz)
Freie Mitarbeiter(innen): Katharina Hausmann (kh), Andreas Hüske (ah), David Kolass, Tadzio Müller (tm), Claudia Wente (cw)
Red.-Schluß für Nr. 47: 30.04.1997
ISSN: 0947-9570
ruprecht im Internet: http://www.uni-heidelberg.de/stud/presse/ruprecht/
Die Redaktion behält sich die Kürzung von Leserbriefen vor. Reinhards Brief ist in voller Länge im Internet zu lesen unter http:/www.uni-heidelberg.de/stud/presse/ruprecht/ausgaben/46/buchheim.htm.
Badesalz. Quietsche-Entchen. Blau Ufer Blau. Schwimmen? Speerspitze. Juventus Urin. Wohl kaum! Aber worum geht es dann? Ganz einfach. Ums Kicken.
Seit den Glanztagen eines Oliver Bierhoff kann man sich einfach nicht mehr mit 08/15-Namen zufriedengeben. Und so kam es, wie es kommen mußte. Seht es Euch selber anhand der Vorrundenergebnisse an.
Während wohl 95% der Studis noch sanft von einer besseren Welt träumten, ging es für 200 Filigrantechniker und Abwehrrecken schon samstags ganz früh aufs heiße Parkett, um Gegner auszutanzen, Flanken wohl zu temperieren, Freistöße an der Mauer vorbeizuzirkeln oder ganz profan den Ball in die Maschen zu dreschen. Lediglich das Team "Speerspitze”, das ohne Torerfolg die heiligen Hallen verlassen mußte, blieb den Beweis seiner Gefährlichkeit schuldig.
Ende Januar war es dann soweit. Die Teilnehmer der Endrunde, die im K.O.-System die Könige der kleinen Tore ermitteln sollten, standen fest. Doch es mußten auch hier wieder einige der harten Hallenbodenrealität früh ins Auge schauen, um nicht zu sagen, ins Gras beißen. Während "Quietsche-Entchen”, "Shakespeare Warriors”, "Geo United” und "Club Med” nicht über das Viertelfinale hinauskamen, öffneten die "Monday Kickers” und "Milan Duracell” ihre Tore zum kleinen Finale zu weit, so daß ihnen nur das undankbare Spiel um den dritten Platz übrig blieb, welches die Mannen von "Duracell” für sich entschieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann trommeln ihre Fans noch heute.
Da solche Turniere bekanntlich ihre eigenen Gesetze haben, waren auch zwei Überraschungsmannschaften im Finale, denn weder die "Latino Lovers” noch "Die, die es hatten” konnten ihre Vor- bzw. Zwischenrundengruppen gewinnen. Doch das war ja auch bei der zeitgleich stattfindenden Konkurrenzveranstaltung, dem Hallenmasters in München, der Fall.
In einem über weite Strecken spannenden und hochklassigen Spiel fiel die Entscheidung erst kurz vor Schluß durch einen hervorragend vorgetragenen und clever abgschlossenen, schulmäßigen Angriff. Tor! 2:0! Und dann die Szenen, die ein jeder von uns schon aus zahlreichen Fernsehübertragungen kennt. Jubel, Torschütze kniet zu Boden, Becker-Faust, Bebeto-Baby, Klinsmann-Diver, nur der Bierhoff-Striptease fehlte noch. Aber "Latino Lovers” haben so etwas wahrscheinlich gar nicht nötig. Zum Schluß war es zwar nicht die Queen, aber immerhin die Organisatoren Michael Schäfer und Rolf Einwiller, von denen sie dann Urkunde und Siegerscheck überreicht bekamen.
Traurige Nachrichten verursachten allerdings in der Hinrunde die Teams "Glückauf Bergfriedhof”, "Lok Marschall”, "Aston Lila” und "Hertha BSE”, die allesamt wegen Nichtantretens disqualifiziert werden mußten. Bei letzteren ist sicherlich das Schlimmste zu befürchten, doch auch hier besteht noch Hoffnung, denn "Die, die es hatten” kamen immerhin bis ins Finale.
(te)
Tabellen der Vorrunde
Gruppe 1
1. Milan Duracell 12:6 10
2. Die Psychos 10:8 9
3. Badesalz 11:10 8
4. Hertha BSE disqualifiziert
Gruppe 2
1. Club Med 16:5 16
2. Monday Kickers 14:3 16
3. Hard Kick Team 16:15 10
4. Sonntag 12:16 10
5. Dynamo Erasmus 9:28 4
Gruppe 3
1. Noname Team 16: 3 21
2. Die, die es hatten 15: 5 19
3. 1.FC Bumm 8:11 12
4. Juventus Urin 4:10 6
5. Glückauf Bergfriedhof disqual.
Gruppe 4
1. Shakespeare Warriors 11: 0 14
2. Quietsche-Entchen 12: 2 12
3. Low Radiation 5: 7 7
4. Speerspitze 0:19 0
Gruppe 5
1. Equipo Infernal 14: 5 16
2. Latino Lovers 17: 9 15
3. Odenwald Brasilianer 15: 8 13
4. Always Ultra 13:11 8
5. Forza Sforzando 3:29 4
Gruppe 6
1. Blau Ufer Blau 10: 3 17
2. Geo United 14: 5 14
3. FC Romanix 14: 7 14
Lok Marstall disqualifiziert
Aston Lila disqualifiziert
Tabellen der Vorrunde
Ein Studi, der in gleißender Hitze Steine schleppt und Dir erzählt, er baue den Weltfrieden auf, der hat das wohl ein bißchen zu wörtlich genommen.
Das stimmt dann schon eher, wenn er später im Schatten der gerade im Schweiße seines Angesichts errichteten Mauer in einer Runde junger Leute aus aller Welt sitzt, die sich über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg bestens verstehen. Völkerverständigung im Kleinen. Die Arbeit an einem gemeinsamen Projekt und der Umgang im täglichen Leben bringen Menschen unterschiedlicher Herkunft besser zusammen als jede theoretische Idee. Man muß ganz einfach die Spaghettisoße der Italiener probiert oder das Sitarspiel der Inderin gesehen haben, um etwas über Kultur und Tradition zu lernen.
Um einen Beitrag zu Frieden und Völkerverständigung zu leisten, bildeten sich unter dem Eindruck der beiden Weltkriege mehrere Vereine, die internationale Workcamps in der ganzen Welt organisieren. Für den Service Civil International (SCI), eine dieser Organisationen, stellte der Wiederaufbau eines im Ersten Weltkrieg zerstörten Dorfes in der Nähe von Verdun 1920 den Anfang dar. Nach und nach schlossen sich immer mehr Länder dem Dachverband an, so daß der SCI nun in über 30 Ländern vertreten ist und mit mehr als 60 Partnerorganisationen zusammenarbeitet.
Für meist mehrere Wochen leben ca. 20 Freiwillige verschiedener Nationalitäten im Alter von 18 bis 26 Jahren zusammen in Zelten, Schulen oder Jugendhäusern, in denen sie gemeinsam kochen, reden, singen, spielen oder faulenzen. Zusätzlich arbeiten sie fünf bis sechs Stunden täglich an einem gemeinnützigen Projekt im ökologischen, sozialen oder kulturellen Bereich. Sei es das Anlegen eines Biotops in Schottland, die Betreuung von Kindergruppen in Polen oder Ausgrabungen in Marokko. Spezifische Vorkenntnisse braucht man in der Regel nicht, und die Palette der Tätigkeiten ist schier endlos. Lediglich das Angebot für Camps in Asien, Afrika oder Lateinamerika ist bei allen Organisationen recht begrenzt. Besonders bei den Aktivitäten in der "Dritten Welt”, aber auch in allen anderen Ländern, richtet sich das Augenmerk hauptsächlich auf die interkulturelle Begegnung und das Voneinanderlernen. Einen Entwicklungsdienst ("denen da unten muß man doch helfen”) will und kann der SCI nicht bieten. Damit sich die Campteilnehmer richtig auf den Freiwilligendienst einstellen können, gibt es für manche Länder im Frühjahr ein Vorbereitungswochenende mit Arbeitsbeschreibung und Diavorträgen. Außerdem gehört zu jedem Camp ein sogenannter Study-Part, der sich z.B. mit dem jeweiligen Land oder ökologischen Anbaumethoden beschäftigt.
Einen durchorganisierten Urlaubsalltag mit Morgengymnastik am Pool darf man natürlich nicht erwarten, vielmehr trägt jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin selbst zur Gestaltung des Gruppenlebens bei. Damit dies funktionieren kann, gibt es eine Campsprache, die meistens Englisch, in manchen Ländern aber auch Französisch oder Spanisch sein kann. Das heißt allerdings nicht, daß man beim Frühstück nicht doch auf fünf oder sechs verschiedene Sprachen trifft, da man ja auch mal seine frisch erworbenen Italienisch- oder Russischkenntnisse anwenden will.
Doch wie immer und überall kosten solche Projekte auch Geld. Obwohl die meisten Vereinigungen vom Bund oder von der EU unterstützt werden, müssen auch die TeilnehmerInnen einen gewissen Anteil selbst tragen, der je nach Organisation zwischen 180 DM und 250 DM für das europäische Ausland liegt; dazu kommen noch die Fahrtkosten. Für die Aufenthalte auf anderen Kontinenten gibt es meist Komplettpreise zwischen 1500 DM und 2000 DM, mit der Option, den Rückflug noch ein wenig nach hinten hinauszuschieben. Es mag zwar paradox klingen, daß man fürs Arbeiten noch bezahlen muß, doch ein "normaler” mehrwöchiger Urlaub ist sicher teurer, und viele Erfahrungen lassen sich nicht in Gold aufwiegen. Bei lockerer Atmosphäre in einer international gemischten Gruppe kann Arbeit zum Vergnügen werden; darüberhinaus entwickelt sich durch ein gemeinsames Projekt ein intensiver Kontakt zur Bevölkerung.
Für ganz Begeisterte eröffnet sich dann noch die Möglichkeit, selbst eines dieser Projekte zu leiten. Er oder sie kann sich auf die Unterstützung der jeweiligen Vereinigung verlassen und diese Tätigkeit als Praktikum anerkennen lassen. Außerdem sind die Veranstalter stets offen für neue Ideen und freuen sich auf Anregungen für weitere Projekte.
Eine Campleiterin meinte einmal, Workcamps seien eine Droge, von der man nicht mehr los käme. Da ist sicher was dran. (kh,te)
Adressen:
Service Civil International (SCI):
Blücherstr.14, 53115 Bonn, regionaler Ansprechpartner: Eike-Frank
Mattukat, 06222/66033
christlicher friedensdienst (cfd):
Rendelerstr. 9-11, 60385 Frankfurt, 069/459072
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd):
Kaiserstr.43, 53113 Bonn, 0228/ 228001
pro international:
Bahnhofstr. 26a, 35037 Marburg, 06421/65277
Gesellschaft für Internationale Begegnung (GIB):
Olefant 14b, 51427 Bergisch Gladbach, 02204/24481
Die Universität hat gezeigt, wo's langgeht: Werbung auf Ausgabezetteln der UB, Merchandising von Produkten mit Uni-Siegel und natürlich sparen wo's nur geht. ruprecht blickte hinter die Kulissen und präsentiert Euch sechs zukunftsweisende neue Projekte.
Uni-Latex!
Auch dieser Traum könnte schon bald in Erfüllung gehen: Kondome mit Uni-Siegel, erhältlich im Uni-Shop, bereichern die Gefühlswelt und stärken das Zugehörigkeitsgefühl der jungen Erwachsenen zu ihrer Universität.
Marlboro präsentiert:
Was im Fernsehen funktioniert, kommt auch bei Klausuren gut. Die Werbung auf den Prüfungspapieren soll aber nicht nur eine Menge Geld einspielen. Tests beweisen eine höhere Motivation durch die Auflockerung des Textes.
Ad mensam!
Noch ist man beim Einkauf zurückhaltend, doch wir sind uns sicher: Britisches Rind ist billig und der heiße Favorit zur Reduktion der Studierendenzahl. Unsere Aufnahme zeigt einen Probanden der ersten Testgeneration.
For Sale!
Wer nichts leistet, wird verkauft! Bummelstudenten werden zum Ausgleich der von ihnen verursachten Unkosten an Reisende aus aller Welt verhökert. Besonders beliebt: Burschis, Alternative und Edelstudis.
Durchgehend geöffnet!
Nach der Einführung eines UB-McDonalds werden nun auch die Mc-Uni-Wochen mit Spannung erwartet
Maßgeschneidertes Angebot
Wer mehr zahlt, soll auch mehr erwarten dürfen: Diskussionsrecht in der Loge, stehend schweigen im Parkett. Für jeden Geldbeutel die richtige Karte.
Die Letzte von: papa, hn, ke; Fotos: papa